2014 titelte die TAZ über die Wallasch-Zwillinge: „German lucky ones“. Das Blatt wollte einen Artikel über die 1964er. Den 50. feierten die zwei zusammen auf der Reeperbahn. Dann die verheerende Diagnose. Ein Überlebensbericht.
 Fotolia
Fotolia
Die Horrordiagnose kam vor wenigen Wochen. „Gegor hat Krebs.“ War da nicht gerade noch unser rauschendes Geburtstagsfest? Gregor besteht heute darauf: „Hamburg, das war der geilste Tag.“
Alexander
Es stand mir wohl ins Gesicht geschrieben. Nicht für jeden, aber für meine Frau, noch bevor ich aufgelegt hatte. Mein eineiiger Zwillingsbruder Gregor hatte aus Herzberg angerufen, aus jener Klinik, in die man gebracht wird, wenn einem im Harz etwas Schlimmes passiert. Sein Unterarm war gebrochen.
Das Körbchen mit den gesammelten Pfifferlingen hatte er zwar noch retten
können, dafür war sein Knochen implodiert. Gammastrahlen im Röntgenzimmer hatten es an den Tag gebracht: ein pathologischer Bruch. Der Knochen zersetzt von etwas, was für die begutachtenden Ärzte alles andere war als nur ein sauberer Bruch oder eine zwar komplizierte, aber ihre Kunst herausfordernde Splitterung, der man mit einer Auswahl spezieller Nirosta-Schräubchen zu Leibe rücken könnte.
Nein, der schwarze verschwommene Fleck dort auf dem Röntgenbild wurde am Abend von den Sichtern in den weißen Kitteln als das ultimativ Böse identifiziert. Die beiden syrischen Ärzte in Herzberg waren sich sicher: Diese Verschattung war noch nicht einmal das Herz der Finsternis. Was man sah, war für sie nur ein fieser Kundschafter des Todes, ein furchtbar schlingernder Satellit des Sensenmannes.
Herzberg kam immer näher. Schild für Schild mit sinkender Kilometerzahl. Dort am Straßenrand schon der erste Klinikhinweispfeil mit dem typischen abstrahierten roten Dach. Dann der letzte Abbieger, und dort oberhalb der Felder, am Ende dieses sanft ansteigenden Hangs die hell erleuchtete Klinik am Waldesrand mit einigen hundert Besucherparkplätzen davor. Ein mehrstöckiger 70er-Jahre-Bau. Betonarchitektur. Bunkerhaft gedrungen. Ging es hier uneinsehbar noch viel tiefer in die Harzer Berge hinein? Folgte da etwa noch ein unterirdischer Klinikkomplex gigantischen Ausmaßes?
Hätte Gregor ein Handy, wir hätten während der Fahrt telefonieren können. In Verbindung bleiben. Aber der Horror aus seinem Mund war ja über die Haustelefonanlage der Klinik in mein Wohnzimmer gekommen und hatte mich in Bewegung gesetzt. Gregor besaß immer nur für kurze Zeit ein Handy, dann verlor er es oder es ging ihm kaputt. Ihm lag wohl einfach nichts dran. Gregor war einer der altmodischen Typen, die lieber 20-Cent-Münzen zum Notfall-Telefonieren irgendwo in der Hosentasche mit sich herumtragen, als eine dieser Telefoniermaschinen, auf die man nur ständig aufpassen muss.
Gregor
Während ich mit meiner Tochter an der linken, der Straßenseite abgewandten, Hand Richtung Schwimmbad schlenderte, zog sie an den aufgeklebten Pflastern auf meinem Handrücken. Ich schaute nachdenklich darauf, und dann fiel mir wieder ein, dass ich damit gar nicht ins Wasser konnte. Für meine anstehenden Bestrahlungen war ich von der Röntgenschwester über und über mit Fadenkreuzen, Linien und Quadraten bemalt worden. Zusätzlich wurden Pflasterbahnen geklebt, die wiederum mit den gleichen Mustern bemalt wurden. Die Farben erschienen mir zwar recht haltbar, aber eine Taufe im Solebad traute ich dem Kunstwerk nicht zu.
Einfach ignorieren und es darauf ankommen lassen? Nein, denn im schlimmsten Fall hätte so eine abgewischte, fürs Anvisieren der Bestrahlungsorte zuständige Nulllinie eine fehlerhafte Ausrichtung zur Folge, was zum Absterben irgendwelcher gesunder Organe führen könnte. An der Stelle am Unterarm links wäre das wahrscheinlich noch zu verkraften gewesen, aber im Schulterbereich oberhalb der Leber und rechts vom Herzen mit fatalen Folgen.
Also entschied ich mich, in Bekleidung am Beckenrand auf diesen beheizten Fliesenbänken den Badespaß des Nichtschwimmerkinds zu überwachen. Am Schwimmbad angekommen, quetschte ich mich mit Tochter und Badezeug durch das Drehkreuz. Die vorgesehenen Kabinen zwischen den Gängen benutzte ich niemals. Das war mir immer zu eng, und diese antiquierte Riegeltechnik, die beim Umklappen Eingang und Ausgang gleichzeitig blockiert, war mir unheimlich.
Die Umkleide, die ich letztlich auswählte, war eine große mit vier Spinden und langer Sitzreihe. Das lag daran, dass an der Tür das Zeichen für Behinderte klebte. So eine puristische Rollstuhlfahrerdarstellung im Kreis. Seit meiner Erkrankung genierte ich mich nicht, dieses Extra zu nutzen. Sollte doch mal einer kommen und nach einem B.-Ausweis fragen. Ich würde ihn schonungslos aufklären über meine Erkrankung, ihn so in die Schranken des Gesunden weisen, um den Platz für Kranke zu behaupten. Die Tochter sprang sofort mit Gejohle ins Becken. Das war verboten, aber die Bademeisterin übersah das Vergehen, weil hier wie meistens kaum jemand im Wasser war, der sich daran hätte stören können.
Lediglich ein Vater mit seinem Sohn planschte auf der anderen Seite. Dafür dauerte es nicht lange, und die Bademeisterin, so eine sportlich-zähe Navrátilová um die 50, kam schnellen Schrittes aus ihrer Kreuzworträtselloge auf mich zu und schimpfte, warum ich Schuhe anhätte, die solle ich sofort ausziehen. Sie bekäme sonst „wahnsinnigen Ärger“ mit anderen Badegästen.
Ich versuchte noch mich herauszureden, dass das Hallenschuhe seien, zog sie dann aber samt Socken aus. So saß ich barfuß in Jeans und langem T-Shirt am Beckenrand und traute mich nicht, meine Füße auf den Boden zu stellen. Ich steckte mitten in einer Chemotherapie. Früher war ich immun gegen Ansteckungsängste, aber dieser geflieste Schwimmbadboden sah schwer nach Fußpilz aus, und mein angeschossener Körper war sicher idealer Nährboden.
Nach einigen Minuten des unschlüssigen Verharrens fasste ich mir ein Herz, setzte erst den rechten, dann den linken Fuß auf, krempelte die Ärmel hoch – es muss wohl um die 30 Grad im Bad gewesen sein – und drehte eine Runde um das Becken. Auf der anderen Seite angekommen, zeigte der badende Junge mit dem Finger auf mich. Der Vater drehte den Jungen aus meinem Gesichtsfeld und flüsterte ihm irgendetwas Erklärendes über die merkwürdigen Klebestreifen zu.
Es schlich sich ein ambivalentes Wohlgefühl ein. Zwar eine kühle, aber eine große, angenehme Klarheit. Wie ein Pfau sein Rad zeigte ich jetzt meine Fadenkreuze und Markierungen. Meine ganz privaten Kriegsbemalungen. Für mich die ultimativen Zeichen einer anstehenden Tortur, die mir keiner abnehmen konnte.

Alexander
Irgendwann dachte ich auch mal: Dem Gregor geht es gut. Natürlich war mir klar, mein Zwillingsbruder hat Krebs. Aber für jemanden, der das nicht wissen konnte, musste es so aussehen, als stände da ein ziemlich zufriedener Mensch vor ihm.
Mein Erklärungsversuch ging so: Diese Krankheit muss für ihn schon jahrelang zu spüren gewesen sein. Solche Tumore in den Knochen – drei waren ja bereits per Röntgenbild festgestellt worden, einer im gebrochenen Arm, einer im achten Wirbel und einer in der Schulter – mussten doch schon über Jahre dieses diffuse Unwohlsein, Schmerzen und weitere unangenehme Begleitumstände ausgelöst haben.
Möglicherweise kam es ja nach dem Schock der Diagnose zu einer spontanen Erleichterung. Schon viel früher kam er manchmal zu mir von der Arbeit im nahen Volkswagenwerk, stand dann irgendwie verdruckst im Türrahmen, ihm tat wieder was weh, und er erklärte im Brustton der Überzeugung Sachen wie: „Alter, ich glaube, ich habe Krebs.“ Und ich antwortete ihm dann meistens grinsend: „Herrje, das ist das Alter, gewöhn dich endlich mal dran.“
Gregor
Der drei Millimeter dicke Draht, im Befund freundlich Implantat genannt, sah auf dem Röntgenbild aus wie eine Vorrichtung für Marionetten. Am aus dem Knochen austretenden Ende erkannte ich auf der Darstellung so etwas wie eine Öse, wahrscheinlich war es aber nur eine kleine Biegung, die Scharfkantigkeit und Verletzungen der darüber liegenden Haut vermeiden sollte.
Ich malte alles schwärzer, als ich es fühlte in den Tagen. Eine Art von Selbstschutz. Ist etwas ganz besonders schlimm, freut man sich bei der nächsten Visite, der Besprechung irgendwelcher Aufnahmen oder dem weiteren Vorgehen über die tatsächliche Halbierung des Vermuteten umso mehr.
Ich nahm für mich in Anspruch, eigentlich nichts zu tun, was der eine oder andere in meiner Situation getan hätte. Ich war mir sicher, der naturnahe Patient würde seine Bücher wälzen und Heilkundige zu Rate ziehen. All das war nichts für mich. Ich trank Wein und rauchte wieder Zigaretten. Was sollte es auch schaden bei alldem, was die Chemotherapie mit maximalem Zerstörungswillen in mich hineinpumpte?
Der Bruder nahm sich die Zeit. Nicht wie die Ärzte in der Klinik, die mich mit ihrem Wissen heilen wollten. Nein, der Bruder erfand mich einfach neu und war auch selbst gleich mit dabei. Wir fingen an zu reden über ein neues Projekt, über ein Buch, das wir nun zu schreiben hätten. Ein Buch über uns Zwillinge, über den Teil unseres Lebens, den wir schon gelebt hatten, über den verfluchten Krebs. Ich sollte ihm alles aufschreiben, was passiert war.
Aber war das am Ende alles nur eine List, die lediglich der Heilung dienen sollte? Eine Art Schreibtherapie anstelle dieser banalen Töpfer- und Buntstiftarbeiten, mit denen sich verzweifelte Patienten sonst so beschäftigen? Egal, denn ich merkte sofort, es traf den Kern. Kein Tag verging nun, an dem ich mich nicht mühte um eine Seite nach der anderen. Um ein Buch, das überdauern soll. So wie ich. Das Schreiben wurde die Blaupause für mein Überleben.
Alexander
Im Verhältnis zur Intensität der Ereignisse verschwammen mir die Erinnerungen merkwürdig schnell. Nicht dass ich mich nicht erinnern konnte, wenn nur wieder der nächste Anstoß von Gregor dazu kam, aber ich wollte es wohl nicht mehr freiwillig, während Gregor sogar danach zu angeln schien, allein schon deshalb, um unser angefangenes Buchprojekt auf Flamme zu halten.
Für mich galt, dass alles unter Adrenalin Erlebte, das mit Gregors Erkrankung zusammenhing, gleich dort, wo es zu tief eingedrungen war, betoniert wurde; schnell und sicher zugeschüttet. Bei Gregor schien es hingegen in irgendeiner Panzerglasvitrine verbunkert zu sein, für den Moment noch relativ gut gesichert zwar, aber immer mit der Möglichkeit, einen Blick darauf zu werfen, wann immer ihm danach war.
Gregor erlebte seine Krankheit am eigenen Leib, konnte sie nicht von sich weisen, während ich nur passiv betroffen war und sofort diesen Mechanismus in Gang bringen konnte, der Abgrenzung heißt, welche nun aber bei Zwillingen einen angeborenen Defekt hat. Von klein auf lernten wir, diesen Defekt als etwas Vorteilhaftes zu sehen. Und tatsächlich fühlte sich unsere Unsterblichkeitsblase doppelt so dickwandig an. Entsprechend lauter geriet dann auch der Knall.
Im nächsten Frühjahr wollen wir gemeinsam nach Norwegen fahren. Gemeinsam in einem dieser weißen Boote sitzen, den Gashebel durchdrücken und ganz weit hinausfahren, dorthin, wohin sich nur wenige wagen, dorthin, wo die kapitalen Dorsche schwimmen. Und dann machen wir einfach den Motor aus, die Angeln klar und lassen unsere Pilker hinunter. Irgendetwas wird schon anbeißen, wenn man mit doppelter Chance unterwegs ist. Und wenn nicht, dann fahren wir einfach den nächsten Tag wieder hinaus.






















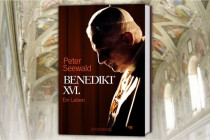





Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein