Ist, wie viele Theologen meinen, zum Alten Testament tatsächlich alles gesagt? Tomas Spahn ist anderer Auffassung. TE veröffentlicht seine Überlegungen zur Entstehung des Monotheismus als Serie. In Teil 1 wurde angerissen, warum biblische Erzählungen als wahre Historie gelten. Lesen Sie heute Teil 2.
 IMAGO / Shotshop
IMAGO / Shotshop
Entgegen der fehlbeurteilenden Arroganz der Nachgeborenen habe ich bei meiner Expedition in die Geschichten des Alten Testaments feststellen können, dass die damals Agierenden den Menschen der Gegenwart in keiner Weise nachstanden. Sie waren nicht weniger intelligent. Sie waren nicht weniger zielgerichtet. Sie waren nicht weniger organisiert. Sie waren auch nicht weniger egoistisch. Und sie haben etwas geschafft, was nach ihnen zahllose Politiker und Philosophen vergeblich versucht haben, ohne sich ihres Versuchs der Wiederholung bewusst gewesen zu sein.
Gern räume ich ein, dass darüber meine Erwartungen an die Weiterentwicklung der Menschheit einen deutlichen Dämpfer erfahren haben. Denn trotz der dialektischen Umkehrung des Leitsatzes des Philosophen Karl Marx, wonach das Sein das Bewusstsein präge, bleibt die Feststellung, dass jene unserer Vorfahren, die vor mehr als zweitausend Jahren lebten und wirkten, viele von uns locker in die Tasche hätten stecken können.
Wenn wir uns ihnen heute – in welcher Weise auch immer – überlegen fühlen, so verkennen wir, dass unser Sein und unser Bewusstsein heute ein anderes ist als jenes zu den Lebzeiten unserer Vorfahren. Und diese Feststellung trifft uneingeschränkt auch auf den Erfinder des Faustkeils zu, der selbstverständlich ebenso zu Recht stolz auf sein Werk sein durfte, wie es ihm nicht anstand, auf die Leistungen seiner Vorfahren herabzublicken.
Der Anstoß bei Finkelstein und Silberman
Doch zurück zu den Darlegungen von Israel Finkelstein und Samuel Asher Silberman. Was sich beim Betrachten der TV-Serie und mehr noch bei dem Studium der Bücher der Archäologen einprägte, war zweierlei.
Zum einen ist es die Feststellung, dass die biblische Beschreibung der Welt im Wesentlichen der Lebenssituation in der beschriebenen Region im achten und siebten vorchristlichen Jahrhundert entsprach. Zum anderen ist es die Darlegung, dass in diesem Zusammenhang ein judäischer König namens Josia eine bedeutende Rolle gespielt zu haben scheint.
Diesen Namen verband ich trotz früherer, partieller Beschäftigung mit dem Alten Testament mit nichts weniger als – nichts. Und das ist in gewisser Weise entschuldbar – denn anders als Mose, David oder Salomo und selbst Hiskia wirkt Josia in den biblischen Darstellungen eher wie eine Randfigur.
So begann ich mich für diese Person zu interessieren. Wenn die Archäologen Finkelstein und Silberman ihm eine wichtige Rolle zuwiesen, dann mochte er ein sinnvoller Anknüpfungspunkt sein, an dem der Einstieg in die erneute Beschäftigung mit dem Tanach ansetzen konnte. Ich kann heute feststellen: Er war es. Das Studium der Bücher der beiden Archäologen gab aber auch weitere Impulse. Einer dieser Impulse war die Darlegung, dass die Hebräer jener Zeit eigentlich Kanaaniter waren. Ich konnte damals noch nicht ahnen, dass diese Auffassung ebenso richtig wie falsch ist.
Der Irrtum beginnt beim Schwein
Es war eine scheinbar belanglose Randnotiz, in der die Autoren den Mangel an Knochen mit Ursprung Schwein in den archäologischen Artefakten des jüdäischen Hochlandes als einen frühen Hinweis auf die Anwendung mosaischer Nahrungsmittelvorschriften interpretierten. So vorsichtig diese Annahme formuliert worden war – mir ist bis heute nicht klar, ob es sich dabei um einen Kotau an die sie umgebende/n Umwelt und Mitmenschen handelte – oder ob sie aus dieser Tatsache tatsächlich zu der Überzeugung gelangt waren, dass die Hebräer schon deutlich vor dem achten Jahrhundert einem jüdischen Lebensmittelkodex folgten. Denn wenn mir meine Besuche in Israel eines gezeigt hatten, dann ist es die Feststellung, dass das judäische Hochland für alles geeignet sein mag – nur nicht für die Schweinezucht. Es gibt jenseits der leichten Verderblichkeit dieses Nahrungsmittels unter der heißen Sonne der arabischen Wüsten und der Trichinengefahr nachvollziehbare Gründe, warum die semitischen Nomaden mit dem Schwein nichts zu tun haben wollten. Denn für eine nomadische Weidewirtschaft ist dieses Tier schlicht nicht zu gebrauchen.
Wenn Mohammed um 600 nc in Übernahme der mosaischen Nahrungsmittelvorschriften dieses Haustier verdammt, dann bediente er damit auch die bis heute wirkenden Vorurteile seiner nomadischen Zielgruppe. Und vermutlich fiel ihm dieses nicht schwer, denn er dürfte selbst mit diesem Vorurteil groß geworden sein. Wer weiß: Vielleicht war Mohammed selbst vor seiner philosophischen Neubesinnung ein Anhänger des jüdischen Glaubens – zumindest wäre die Vehemenz, mit der der Koran an zahlreichen Stellen gegen die Israeliten wettert, nicht ungewöhnlich für die Energie, mit der manche Konvertiten den von ihnen verlassenen Glauben bekämpfen. Die Tatsache jedenfalls, dass Mohammed sich vom jüdischen Glauben mehr noch als vom Christentum inspirieren ließ, belegt zumindest eine umfassende Kenntnis dieser Glaubensphilosophie.
Wenn jedoch Finkelstein und Silberman im Jahr 2000 nc diese Selbstverständlichkeit übersehen, dann belegt dieses, dass auch ihr Denken an der einen oder anderen Stelle in Korsettstangen gefangen ist. Mögen es auch nur wenige sein.
Doch genug dieser Kritik, die die Leistung der beiden Archäologen in keiner Weise herabwürdigen soll. Für mich folgte nunmehr die Frage, in welcher Form ich mich der mir gestellten Aufgabe annehmen sollte.
Das Problem der Quellen
Es stand zu diesem Zeitpunkt fest, dass meine Auseinandersetzung mit Josia nichts anderes sein sollte als eine geistige Übung, eine Ablenkung vom Tagesgeschäft der Kommunikationsbranche. Nicht im Raum stand für mich die Vorstellung, hier mehr als die Unterstützung oder aber auch die Widerlegung einer spannenden These zu finden. Da aber für mich das Schreiben immer auch ein Experiment ist, galt es, sich Gedanken darüber zu machen, wie man ein solches Kleinprojekt – denn mehr war es zu diesem Zeitpunkt nicht – zweckmäßig anzugehen hätte. Dazu gehörte auch die Frage, welcher Quellliteratur ich mich bedienen sollte.
Der seit meiner Konfirmationszeit im Regal stehende Bibeltext der im Jahr 1964 vom Rat der evangelischen Kirche in Deutschland genehmigten Fassung bot zwar eine Basis, schien mir aber als Quelltext im eigentlichen Sinne ungeeignet. Diese Annahme sollte sich schnell als zutreffend erweisen, als es um die Frage ging, wie bestimmte Bezeichnungen und Eigennamen wirklich zu verstehen seien.
Ein weiteres Hindernis dieser und anderer lutherischer Ausgaben ist die mehr als freizügige Übersetzung der zahlreichen Gottesbegriffe, mit denen der Tanach arbeitet. Die lutherische Bibelfassung setzt dort, wo von Jahwe die Rede ist, die Bezeichnung HERR.
Glaubensphilosophisch mag das kein Problem darstellen. In der Arbeit mit dem Text wird das jedoch nicht nur deshalb schwierig, weil eine Volltextsuche, die zwischen Groß- und Kleinschreibung nicht unterscheidet und so eine Unmenge von Ergebnissen produziert, jedes Herangehen auf diesem Wege zu einer Sysiphos-Arbeit werden ließe.
Gänzlich unabhängig davon ist dieser übersetzte Text – möglicherweise quellbedingt – voll von Verklausulierungen, die selbst der Übersetzung in eine verständliche Sprache harren. Ursächlich dafür mochte nicht nur der hebräische Tanach sein, sondern mehr noch die Tatsache, dass Luther seinen Text auf Basis der griechischen Version des Erasmus von Rotterdam und der griechischen Vulgata entwickelte. So stellte sich die Frage, wie weit überhaupt diese Versionen sich am Original orientierten – und welches dieses Original gewesen sein könnte?
Fast schon zwangsläufig kam es zu der Beschäftigung mit den Quellen der übersetzten Bibel, die in der Abhandlung „Quellenlage des Tanach“ ihren Niederschlag fand. Die Ergebnisse waren eher ernüchternd. So war festzustellen, dass die ältesten uns bekannten Tanach-Texte jene Relikte aus dem Fund von Qumran sind. Und diese wiederum sind keinesfalls vor 300 vc entstanden. Sie liegen damit vom geschilderten Geschehen je nach Inhalt mindestens zweihundert Jahre entfernt.
Zwischen den Geschehnissen rund um Josia sind es mehr als dreihundert Jahre; zu der legendären Geschichte von David und Salomo schon siebenhundert – und zu der Erzählung des Exodus um die eintausend. Gleichzeitig gibt es den Hinweis auf die Septuaginta, die offenbar die Urschrift mehrerer Tanachtexte in griechischer Schrift und Sprache gewesen ist.
Keine Quelle vor Alexandria
Für eine geschichtswissenschaftliche Bewertung ist eine derartige Quellenlage in gewisser Weise prekär. Denn es stellt sich notwendig die Frage, ob und welche Veränderungen am behaupteten Urtext in den zwischenliegenden Jahrhunderten erfolgt sind. Gemäß der aus heutiger Sicht eher fragwürdigen Auffassung, der Tanach sei Stück um Stück gewachsen und habe in seinem Entstehungsprozess den Weg des Volkes Israel seit Mose begleitet, ist in einer solchen Situation die Authentizität der Quelle grundsätzlich zu hinterfragen. Andererseits – und auch das ließ Rückschlüsse zu – ist die große Nähe der griechischen Bibelversion zu den noch heute genutzten Tanachtexten unbestreitbar auch dann, wenn Details Abweichungen aufweisen. Ohne die Details der Überlegungen hier schildern zu wollen, darf im Ergebnis davon ausgegangen werden, dass zwischen 300 und 200 vc eine weitgehend in hebräischer Schrift und Sprache gehaltene Tanachversion vorgelegen hat, die Grundlage sowohl der griechischen als auch der heute genutzten hebräischen Versionen gewesen ist.
Die Tatsache wiederum, dass wir keine älteren Quellen haben und die hebräischen Teilquellen ebenfalls nicht älter sind, lässt die Annahme zu, dass der geschriebene Tanach sich nur einer geringen Verbreitung erfreute. Ganz offensichtlich war dieses Werk – anders als heute die christliche Bibel in ihren zahllosen Varianten – nicht in jedem zweiten Haushalt anzutreffen. Mehr noch als diese Feststellung bewegte mich jedoch die Frage, warum die in unseren christlichen Sprachgebrauch eingeflossenen Versionen der biblischen Eigennamen mit Jahwe-Bezug eben genau diesen Bezug oftmals nicht aufweisen. Ein Josia beispielweise müsste – orientierten wir uns am Tanach – eigentlich ein Josijahu sein. Ein Zedekia ein Zedekjahu, ein Asarja ein Asarjahu und so weiter.
Die alexandrinische Übersetzung
Erklären ließ sich dieses Phänomen möglicherweise damit, dass die Übersetzer in das Griechische eine Dialektfassung vorgefunden hatten. So zumindest versuchte auf irgendeiner unbedeutenden Website der dortige Autor diese Unschlüssigkeit zu erklären. Aber das macht keinen Sinn. Zwar gibt es heute auch Bibeln in Plattdeutsch oder anderen Regionalsprachversionen, doch der Blick beispielweise auf den Koran macht deutlich: Die Gläubigen eines Gotteswerkes, das sie in der eigenen Alltagssprache lesen können, achten peinlich genau darauf, dieses nicht durch sprachliche Regionalisierung zu verfälschen. So können wir diese Vorstellung zumindest für die Zeit um 300 vc als äußerst unwahrscheinlich zu den Akten legen.
Etwas weiter mag uns die Annahme bringen, dass zumindest die Übersetzer ihren gesprochenen Dialekt in die von ihnen erstellte Version einbrachten. So wäre es immerhin vorstellbar, dass die Griechen oder die der griechischen Sprache mächtigen Juden im Alexandria des dritten vorchristlichen Jahrhunderts den Jahwe des Tanach als „Jah“ ausgesprochen haben und das abschließende u verschluckten. Aber machte das Sinn? Kaum, denn die hebräische Sprache des Tanach ist voll von „~jah“-Endungen, die keinen Bezug zu Jahwe herstellen. Wenn überhaupt, so wäre zu unterstellen, dass ein hebräischer Dialekt, der zu jener Zeit in Alexandria gesprochen wurde, gerade um dieser Unterscheidung Willen das „~jahu“ als „~ja‘u“ ausgesprochen habe. Dieses könnte, wie es bei den griechischen Versionen Joahas oder Jojakim den Eindruck erweckt, zu einem gesprochenen „~jo“ geschliffen worden sein – keinesfalls jedoch zu einem klaren „~jah“.
Josia oder Zedekia hätten in diesem Falle als Josio oder Zedekio ihren Weg in die Septuaginta finden müssen. Theoretisch vorstellbar wäre es allerdings immerhin, dass die Griechen die für sie kaum aussprechbaren semitischen Namen grecisiert haben. Dann aber wäre dabei aller Wahrscheinlichkeit nach ein Josiao und ein Zedekiao herausgekommen. Hinzu kommt ein weiteres. Das hebräische ו (waw) entspricht eben nicht dem germanischen u. Es bleibt konsonantisch und erhält seine vokale Funktion erst durch das gesprochene Wort. Und so steht das J-H-W-H eben nicht für ein klangliches „jahuh“, sondern für ein „jah-wah“, vielleicht sogar für ein „jahewah“ mit einem nur angedeuteten „e“. Entsprechend ist das J-H ein „jah“ und das J-H-W ohne das abschließende H tatsächlich ein „jahu“, wobei das „u“ eher einem w-Wert entspricht und zu einem „ja-uw“ wird.
Probleme der Transliteration
Folglich tendierte ich bereits damals zu einer Möglichkeit, von deren Richtigkeit ich mittlerweile fest überzeugt bin und die bei einem Blick in die Qumrantexte durchaus Unterstützung findet: Die ~jahu-Endungen, die wir heute in den bekannten Tanach-Versionen finden, waren genau dort zwischen 300 und 200 vc nicht vorhanden. Die jüdisch-griechischen Autoren der Septuaginta hielten sich fast schon akribisch an die ihnen vorliegende Version: Sie transferierten die Namen unter Anpassung an die von ihnen gesprochene griechische Sprache recht lautgetreu in ihr Werk. Aber sie transliterierten sie nicht. Das wiederum bedeutete: Der Josia des frühen Tanach kann kein Josiahu und der Zedekia kein Zedekiahu gewesen sein. Der scheinbare Gottesbezug auf den heute geläufigen Jahwe muss zu einem späteren Zeitpunkt in den hebräischen Text Eingang gefunden haben.
Oder lag hier ein Denkfehler vor? Hätten in einem solchen Falle nicht Namen wie Jojakim oder Joahas notwendig als Jahjakim oder Jahahas transferiert werden müssen? Beruhen die uns geläufigen Namen also doch auf einer regionalen Prägung der Sprechweise jener Dolmetscher?
Um diesen scheinbaren Widerspruch zu verstehen, ist die Beschäftigung mit der semitischen Sprache unumgänglich. Hierbei kam mir das universitäre Studium der Grundzüge des Arabischen zu Hilfe. Auch wenn ich mangels weiterer Beschäftigung und Anwendung dieser interessanten Sprache weit davon entfernt bin, auf Arabisch kommunizieren zu können, so war mir nicht nur der Verzicht der semitischen Sprachen auf jegliche Vokale gut in Erinnerung. Folglich ging es daran, die biblischen Namen aus der grecisierten Version zurückzuführen auf ihren Konsonantengehalt. Dabei blieb für einen Josia unter der Annahme, dass das abschließende „ia“ jenen „Jah“-Bezug erstellen sollte, die Konsonantenreihe J-(W)-S-J-H und für einen Zedekia die Konsonantenreihe Z-D-K-J-H. Jojakim wiederum wird zu J-(W)-J-H-K-M und Joahas zu J-W-A-H-A-S.
Wer nun einen Blick in den Tanach wirft, wird unschwer feststellen, dass diese Rückübertragungen den dort anzutreffenden Originalen nicht unbedingt gerecht werden. Und dieses hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass dem Europäer einige der semitischen Konsonanten wie Vokale erscheinen wollen.
Es beginnt bei dem Alif [א], einem Stimmritzenlaut, den die griechisch-jüdischen Dolmetscher völlig skrupellos zu einem α transformierten. Tatsächlich aber ist es dieses nicht. Warum das so ist, wurde in den lexikalischen Einschüben des Abschnitts „Semitische Schrift und Sprache“ dargelegt.
Ähnliches gilt für das Ajun [ע], von den Griechen in der Regel zu einem ω umfunktioniert. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen nahen Verwandten des Alif – ein Blick auf das Vokaldiagramm im entsprechenden Abschnitt des Biblikon-Projekts macht die Nähe deutlich.
Das Waw [ו] ist ein weiterer Kandidat, der den Griechen Probleme bereitet haben dürfte. Im Arabischen ist dieser Buchstabe in Alleinstellung als „wa“ ein „und“ – im hebräischen ist es nicht anders, nur dass er dort unmittelbar an das zu verbindende Wort als Präfix angefügt wird. Die griechischen Dolmetscher neigten dazu, aus dem Waw ein u zu zaubern. Tatsächlich aber bleibt es in den altsemitischen Sprachen und im Arabischen bis heute ein gehauchter w-Laut.
Scheinbar letzter Kandidat ist das Jah [י], das die Griechen zu einem i wandelten. Tatsächlich aber bleibt es ein J-Laut, der am hinteren Gaumen gebildet wird.
Der mit dem Semitisch unvertraute Europäer hat infolgedessen ein Problem, wenn er auf schriftlich niedergelegte Texte in hebräischer Sprache trifft: Wie soll er die Konsonanten sinnvoll verbinden? Ich habe in dem Abschnitt „Semitische Schrift und Sprache“ das Beispiel Salomo gewählt, der sich als heute gebräuchlicher Vorname in der hebräischen Kultur als Schlomo ausspricht. Tatsächlich besteht auch dieser Name im Original nur aus Konsonanten: Sh-L-M-H.
Damit nun kommen wir zu dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, der für die griechischen Dolmetscher Vokalcharakter entwickelt, ohne diesen zu haben: das He [ה]. Dieser Buchstabe hat mehrere Funktionen. Er kann als Präfix verwendet werden und steht in diesem Falle für den persönlichen Artikel – das „the“ der englischen oder das „der, die, das“ der deutschen Sprache. Es personalisiert folglich den nachfolgenden Begriff, sodass aus einem unpersönlichen König (M-L-K) oder Priester (K-H-N) über das H-M-L-K beziehungsweise das H-K-H-N „der König“ oder „der Priester“ im Sinne eines „dieser König / Priester“ wird.
Weiterhin findet das ה eine verbale Anwendung, indem es Tätigkeitswörter einleitet. Es hat hier eine ähnliche Funktion wie bei der Voranstellung an ein Substantiv im Sinne von „derjenige, welcher“ etwas tat. In beiden Fällen wird es im Ivrit – dem zeitgenössischen Hebräisch – mitgesprochen. Ein Blick auf semitische Untersprachen wie beispielweise das Maltesische zeigt jedoch, dass es durchaus als Quetschlaut seinen Weg in die Kommunikation finden kann. So wird auf der Mittelmeerinsel beispielweise „hagar“ (Fels, Stein) eher wie „~ádjschar“ ausgesprochen. Häufiger noch findet sich das ה im Ivrit als Silben- und Wortende – und übernimmt hier die Funktion einer Vokaldehnung, obgleich es eigentlich keinen Vokal gibt.
Lesen Sie in Teil 3 über die Sprache der Bibel und den Umgang damit.
Die Kommentar-Funktion ist bei dieser Serie nicht aktiviert, da der Autor nicht mehr antworten kann.























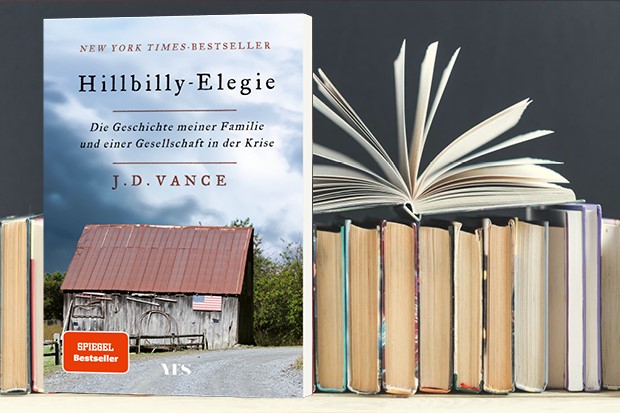





Liebe Leser!
Wir sind dankbar für Ihre Kommentare und schätzen Ihre aktive Beteiligung sehr. Ihre Zuschriften können auch als eigene Beiträge auf der Site erscheinen oder in unserer Monatszeitschrift „Tichys Einblick“.
Bitte entwerten Sie Ihre Argumente nicht durch Unterstellungen, Verunglimpfungen oder inakzeptable Worte und Links. Solche Texte schalten wir nicht frei. Ihre Kommentare werden moderiert, da die juristische Verantwortung bei TE liegt. Bitte verstehen Sie, dass die Moderation zwischen Mitternacht und morgens Pause macht und es, je nach Aufkommen, zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hinweis