Die Freistaats-Grünen und die ihnen angeschlossenen Helfer änderten mehrmals ihre Wahlkampfstrategie. Es half ihnen nichts. Wer wissen will, warum zwei Drittel Mitte bis Rechts wählten, versteht es am besten, wenn er dem anderen Teil zuhört.
 IMAGO
IMAGO
Es gibt eine Bayern-Hymne, ein Bayern-Ticket (ab 27 Euro), in der Brauereiwerbung auch den Himmel der Bayern. Ein Bayern-Gen, dessen Entdeckung Dr. Markus Söder für sich in Anspruch nimmt, eher nicht. Schon Bayern selbst teilt sich bekanntlich in Ober- und Niederbayern auf. Das mehrfach unterteilte Franken wiederum stellt etwas ganz anderes dar, was vor allem viele Franken bestätigen, wenn auch nicht unbedingt Markus Söder. Dazu kommt auch noch Schwaben. Außerdem der virtuelle vierte Stamm des Landes – nicht die inzwischen diffundierten Sudetendeutschen, sondern die aus allen Richtungen Zugewanderten, zu denen übrigens auch die aus Baden nach München migrierte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze zählt. Ihr Problem, das soll sich in diesem Text noch zeigen, liegt aber nicht darin.
Es gibt also kein Bayern-Gen. Aber ein Gefühl beziehungsweise bei manchen ein Nichtgefühl für dieses Land. Zu den Besonderheiten des Freistaats gehört zum einen die Fähigkeit, rein rechnerisch mit seinen Finanzausgleichsmilliarden ganz Berlin auf Zweitweltniveau zu halten. Schon dieser Umstand allein nährt dort und anderswo in der Zeit zwischen den Landtagswahlen den Bayernhass. Zur Landtagswahl selbst übernimmt das Ergebnis diese wichtige Funktion.
— Max Czollek (@rubenmcloop) October 8, 2023
Denn Bayern stellt die letzte und offenbar unknackbare nichtgrüne Festung innerhalb Deutschlands dar. Dass gut zwei Drittel mit der von Berlin aus konzipierten großen Umgestaltung nichts anfangen können, liegt an der besonderen Mentalitätsmischung. Die besteht zum einen aus Selbstbewusstsein und Eigensinn: Wer eine ganze Hauptstadt zwangsweise finanziert und trotzdem noch etwas übrig behält, darf sich zum Ausgleich, siehe oben, wenigstens für leistungsfähig halten. Tradition, Fleiß und Eigentum stehen hier in keinem schlechten Ruf, vor allem in ländlichen Gegenden mit Bauernhöfen, Handwerksbetrieben und mittelständischen Firmen, betrieben oft schon in dritter oder vierter Generation.
Drittens kommt die Schönheit der Landschaft in einigen von der Natur besonders privilegierten Ecken dazu. Und die führt dazu, dass es außerhalb der Städte, also dort, wo garantiert keine Windparks entstehen, nur einen sehr mäßigen Zuspruch für die Forderung der Katharina-Schulze-Partei gibt, das Land von Franken bis ins Alpenvorland mit Rotoren zu bepflastern. Selbst die lokalen Grünen wehren sich beispielsweise gegen einen geplanten Windpark im Staatsforst bei Altötting, den die Funktionäre der eigenen Partei in Schwabing für alternativlos halten, wenn es darum geht, die Welt vor dem Hitzetod zu retten.

Womit wir bei dem Gefühl beziehungsweise Nichtgefühl für Bayern wären. Ursprünglich wollten die Grünen die Landtagswahl zu einer Abstimmung über die Energiewende inklusive Heizungsgesetz machen, was schon für eine schwerwiegende Verkennung von Land und Stimmung spricht, zumal der Spitzenkandidat Ludwig Hartmann am Jahresbeginn das Wahlziel von „20 Prozent plus einem sehr großen X“ ausgab. Der gleiche Ludwig Hartmann empfahl älteren und finanzschwachen Hausbesitzern per Interview, einfach ihren Kaminkehrer zu fragen, wann sie die alte Heizung gegen eine neue austauschen müssten. Zumindest redete er im Frühjahr noch so, als die Grünen davon ausgingen, das Graichen-Gesetz ohne größere Widerstände bundesweit durchsetzen zu können.
Anders, als es das Klischee will, gibt es zwar Inseln des Reichtums in Bayern, aber auch große ländliche Gebiete mit älteren Häusern und Besitzern, die über keine großen Rücklagen verfügen. Und in einer Gegend mit vielen Nettosteuer- und Länderfinanzausgleichszahlern wirkt es außerdem nicht popularitätssteigernd, auf staatliche Fördermittel für einen Heizungsaustausch hinzuweisen, den die meisten Leute erstens für überflüssig halten, und für den sie weder direkt noch mit ihren Abgaben zahlen wollen. Das Beispiel der Grünen, die für den Heizungsumbau aka energetische Sanierung ihrer Parteizentrale in Berlin Mitte drei Jahre brauchten, wobei sie für das Projekt fünf Millionen Euro veranschlagen, dringt auch zu den Hillbillies in der Oberpfalz und anderen Landstrichen vor, in denen die Kosten des Habeckplans für das einzelne Haus den Immobilienwert meist sehr deutlich übersteigt.
Dazu kommt noch die grüne Forderung, Moore wiederzuvernässen und damit Anbaufläche zu beschneiden und die Großvieh-Stückzahl pro Bauer zu reduzieren. Wenn die Partei dann noch in ihrer Wahlwerbung zwei kleine Waldfeuer bei Aschaffenburg und Miltenberg, einmal auf 4.000 und einmal auf 250 Quadratmeter, zum Menetekel für den Klimanotstand erklärt, und die Anwohner gleichzeitig unter Vermischtes lesen, dass die Polizei von Brandstiftung ausgeht, dann denken sie sich als Bürger mit Wahlrecht ihren Teil.
Das allein hätte aber das grüne Ergebnis vermutlich noch nicht so weit heruntergerissen, wenn sie nicht in der sogenannten Flugblatt-Affäre zusammen mit der Süddeutschen, Hauptstadtmedien und allen möglichen wohlgesinnten Gruppen alles auf eine Karte gesetzt hätten. Eigentlich schon ein paar Wochen vorher, nachdem der Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger und Ministerpräsident Markus Söder in Erding vor einer Menge sprachen, die gegen das Heizgesetz demonstrierten, wobei der Wirtschaftsminister etwas direktere Worte wählte als der Regierungschef.
Insbesondere sein Satz: „jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss“, gemünzt auf die Tatsache, dass bundesweit gut zwei Drittel der Bürger und in Bayern noch etwas mehr das Heizgesetz ablehnten, verstanden die Verantwortlichen in Berlin und ihre Ableger in Bayern schon ganz richtig als Generalangriff auf ihre Deutungshoheit. Denn aus deren Sicht zählen nicht Mehrheiten, sondern die Richtigkeit einer Maßnahme selbst beziehungsweise erst recht dann, wenn es den Leuten an Einsicht fehlt. Katharina Schulze sagte nach Erding einen Satz, der auch von Bernd Zeller oder Karl Valentin hätte stammen können: „Wer Öl ins Feuer schüttet, der sägt an der Demokratie“. Eine Koalition aus Grünen, Verdi, Vorfeld- und Nebengruppen wie der bayerischen SPD und den entsprechenden Trabanten in den Medien trommelte einen Kundgebung gegen Aiwanger und auch ein wenig gegen Söder in München eine Kundgebung unter dem Motto „ausgetrumpt“ zusammen.
Der Vorsitzende der unglücklichen bayerischen Sozialdemokraten Florian von Brunn steuerte anschließend ebenfalls einen Schulze-Zeller-Valentin-Satz bei: „Gestern haben wir gemeinsam gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen sich nicht spalten lässt.“
Dabei blieb es aber nicht. Das nur auf dem Odeonsplatz breite Bündnis beschloss, dass Aiwanger aus der Politik zu verschwinden hätte. Dabei ging es nicht nur um Machtansprüche in Bayern, sondern auch darum, bundesweit ein Exempel zu statuieren. Dafür ergab sich mit der Flugblatt-Affäre, ob nun durch Koinzidenz oder mit leichtem Anschub durch die SPD, die ideale Gelegenheit. So jedenfalls der Gedanke, der Plan, die Erwartung. Denn die Süddeutsche, aufspringende Kollegen und Unterstützer beschränkten sich eben nicht darauf, Hubert Aiwanger als seit 35 Jahren bestens getarnten Rechtsradikalen und Antisemiten zu enttarnen und zu vernichten. Sondern es ging von Anfang an auch um seine Wähler. Um diejenigen, die seine Rede in Erding beklatschten, um die Leute, die zu seinen Veranstaltungen ins Bierzelt kommen, um dort zu trinken, eine dialektgefärbte Ansprache zu hören und selbst Niederbairisch zu reden. Kurzum, es ging um alles, wovor sich Funktionseliten ekeln, die sich bedenkenlos für den Maßstab des Richtigen und Anständigen halten. Es ging also um oder vielmehr gegen das Bierzelt und alles, wofür diese Einrichtung steht.
„Wenn Söder oder Aiwanger im Bierzelt sprechen“, so der Chefreporter der Süddeutschen Roman Deininger in einem Podcast, „ist das wirklich so eine schwitzige Massenveranstaltung. Da steht einer vorne, nimmt das Sakko ab, weil er das Hemd durchgeschwitzt hat. Unten sitzen auch Leute, die auch schwitzen und sich in den Rausch klatschen.“

In szenischen Beschreibungen solcher Auswüchse durch die Süddeutsche und verwandte Medien spielt die Beschreibung von Schweiß zuverlässig eine große Rolle, neben der Schilderung von Liedgut, Fleisch- und Getränkeverzehr. Transpiration gilt in diesen Kreisen als Eigenschaft moralisch niederer Stände. Rausch ebenfalls, falls die Massen ihn ganz konventionell durch Trinken und Klatschen erzeugen. Es gab in den Tagen der Berichterstattung, in denen Aiwanger praktisch schon als erlegt galt, kaum einen Bericht ohne das Bierzeltelement. Für einen Augenblick konnten sich die bayerischen Kämpfer für Anstand und beaufsichtigte Demokratie ebenfalls als Teil einer Masse fühlen, die sich in einen Rausch klatschte.
Der größte Teil davon allerdings agitiert, schreibt, sendet und twittert außerhalb Bayerns. Aber dieses Detail ging in den Tagen unter, als es aussah, als wäre der Sieg über das als Auenland getarnte Mordor nur noch Formsache. In Redaktionen und Parteizentralen arbeitete man schon an Besetzungslisten für ein schwarz-grünes Kabinett in München. Und später vergaßen sie die Bayern-und-Außerhalb-Relation noch viel mehr, später, als sich zeigte, dass die ganze Aktion, um mit Rühmkorf zu sprechen, die andere Kehre nahm. Künftig stehen in Fachbüchern für Medienwirkung im Kapitel zeitloser Modellfälle wahrscheinlich der Streisand- und der Aiwanger-SZ-Effekt gleich nebeneinander, um von den Medienanwälten und Redakteuren der nächsten Generationen geflissentlich ignoriert zu werden.
Im Abwehrkampf jedenfalls, als dpa fassungslos meldete: „Aiwanger macht einfach weiter“, als der Chefredakteur der „Süddeutschen“ drohte, jetzt würde auch Söder für seine Weigerung, den Chef der Freien Wähler hinauszuwerfen, in den verdienten Abgrund gerissen, als Reporter zur Safari nach anonymen Zeugen aus Aiwangers Schulzeit ausschwärmten und sich die Wohlgesinnten republikweit über den fehlenden Anstand der Bayern erregten, die nicht zum spontanen Protest vor das Wirtschaftsministerium in der Prinzregentenstraße zogen, in diesen Tagen festigte sich das Band zwischen den Progressisten in Bayern und denjenigen, die Bayern in bewährter Weise von außen beurteilen, noch viel, viel mehr.
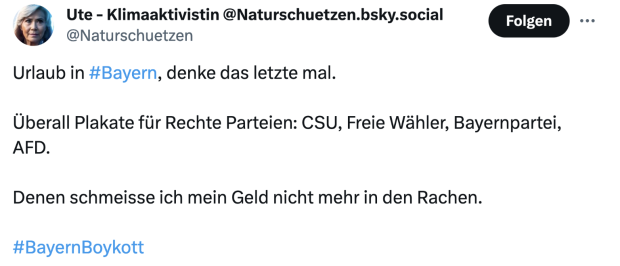
Es gab also spätestens zu diesem Zeitpunkt eine sehr scharfe Frontenstellung ohne die kleinste Aufweichung hier und da, die sich die Grünen aus taktischen Gründen gewünscht hätten: Hier der urbane progressive Anstand, dort die schwitzige verstockte Provinz, in der Bürger die Reporter und auch die einen oder anderen grünen Wahlkämpfer allen Ernstes wissen ließen, für sie gebe es wichtigere Themen als ein Flugblatt aus den Achtzigern. Womit sie natürlich weiteres Öl auf die Sägemühlen derjenigen kippten, die sich an den Säulen der Demokratie zu schaffen machen.
Nach etwa anderthalb Wochen zeigte sich, dass die Sache, wie man in Bayern sagt, sich nicht ausging, jedenfalls nicht in der von den Grünen, SPD und Begleitern erhofften Weise, die jetzt erklärten, die Landtagswahl nicht mehr zur Abstimmung über die Energiewende, sondern zum Plebiszit über Anstand und gegen Spaltung machen zu wollen. Bei dem Aufruf gegen die Spalter erinnerten sich ziemlich viele, Städter wie Bewohner ländlicher Gegenden, an Katharina Schulzes Satz in einer Landtagsrede: „Der Handel muss endlich für die Ungeimpften geschlossen werden.“ Beim Stichwort ‚Anstand‘ fiel dem einen oder anderen noch ihr Video von 2020 ein, in dem sie grienend, glucksend und zwinkernd – hey – über islamistische Morde in Frankreich und ihr tolles Maßnahmepaket plauderte.
Überhaupt eignete sich eine Spitzenkandidatin, die sich ansonsten völlig freiwillig als Frettchen auf Ecstasy inszeniert, weil PR-Strategen meinten, so etwas käme bei Jungwählern gut an, denkbar schlecht für die Rolle der Staatsfrau, die jetzt auf einmal Anstand und den Ruf Bayerns vor den Schwitzigen retten wollte.
Die gesamte Strategie der Wohlgesinnten beruht auf der Annahme, in dem doch recht großen Freistaat bekäme niemand mit, wie eben dieses Milieu, das dort auch jenseits der Städte um Stimmen buhlt, in den Politik- und Medienzentralen über Land und Leute denkt und redet. Selbst in deren urbanen bayerischen Stützpunkten hält sich der Glaube, sie könnten mit ihrem Ekel vor den schwitzenden Deplorables unbemerkt unter sich bleiben. Sie folgern das aus der Annahme, dass nur wenige Leute im niederbayerischen Mallersdorf die Süddeutsche lesen. Das stimmt zwar. Trotzdem wissen die Leute dort im Großen und Ganzen, wie das Blatt über sie schreibt, und was die Schreibenden über sie denken, wenn sie sich in ihren privaten Runden in einen Rausch reden.
Katharina Schulze, Ludwig Hartmann und den anderen ging es so ähnlich wie den Hillary-Clinton-Anhängern 2016, die merkten (allerdings zu spät), dass sie die Stimmen der Deplorables in den Appalachen und im Rust Belt doch ganz gut hätten brauchen können. Es ging ihnen wie den polnischen Linken, über deren Wahlkampf von 2020 der polnische Autor Szczepan Twardoch schrieb:
„Wie üblich waren die Intellektuellen, Fernsehstars, Schauspieler, Sänger, Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht in der Lage, ihre Verachtung für die, wie sie genüsslich betonten, nach Wodka und Wurst stinkenden, alten, ungebildeten Dorfbewohner zu zügeln, die auch noch die Frechheit besäßen zu wählen: Die Alten vom Land schreiben den Jungen mit ihren Wahlstimmen vor, wie Polen zu sein hat! Schrecklich! Deren Wahlstimmen wiegen genauso viel wie die Wahlstimmen der Klugen, Aufgeklärten, gut Gekleideten und sich regelmäßig die Zähne Putzenden! Oh Graus! […] Doch welche Alternative boten die fellow travellers von der Bürgerkoalition (KO) den Wählern? Stimmt für unseren Kandidaten, auch wenn wir euch zutiefst verabscheuen und eine Welt wollen, in der nach Wodka und Wurst stinkende Menschen nichts mehr zu sagen haben? Schwer zu sagen, ob diejenigen, die sich öffentlich so äußern, einfach nur nicht wollen, dass die ihrer Ansicht nach unwürdigen Wähler für ihren Kandidaten stimmen – oder ob sie tatsächlich glauben, Menschen durch Beschimpfen und Erniedrigen überzeugen zu können.“
Twardoch schilderte bei dieser Gelegenheit ein Muster, dass sich so nicht nur in Polen findet, sondern innerhalb des gesamten regressiv-progressiven Milieus im Westen:
„In einer Folge der Zeichentrickserie ‚Die Simpsons‘ will Lisa feststellen, ob ihr Bruder Bart dümmer ist als ein Hamster. Zu diesem Zweck setzt sie das Essen unter Strom. Der Hamster hat nach dem ersten Stromschlag genug, Bart dagegen macht sich immer wieder an den unter Strom stehenden Kuchen heran: ‚Aua. Aua. Aua. Aua. Aua.‘ Die liberale polnische Intelligenz benimmt sich seit Jahren so wie Bart. Sie agiert immer auf die gleiche Weise und wundert sich, dass sie immer zu den gleichen Ergebnissen kommt.“
In Vorahnung der kommenden Schmerzen am Wahlabend versuchte das Milieu schnell noch die nächste und vorletzte Wendung. Der Grünen-Werbespot kurz vor der Wahl zeigte gleich in der ersten Aufnahme ein Kirchlein mit völlig windradfreier Bergkulisse im Sonnenschein. Die Partei schob mehr und mehr den etwas seriöser wirkenden Ludwig Hartmann nach vorn. Katharina Schulze zeigte sich so oft wie möglich in Tracht. In jeder Rede benutzte sie die Formel „unser schönes Bayern“. Söder und die CSU, die sie noch Wochen vorher bei dem „Ausgetrumpt“-Aufmarsch als fast so schlimm wie Aiwanger abkanzelten, avancierte plötzlich zum umschmeichelten Partner beim Projekt Demokratie-Rettung.
Ein kurzer Blick auf die Werte der Grünen zeigte: Das nutzte ihnen nicht das kleinste Bisschen. Wer erst auf die berechtigten Sorgen von Immobilieneigentümern antwortet: ‚fragen Sie ihren Kaminkehrer‘, Windparks bis zu den Alpen vorschlägt, wer jeden, der das Heizungsgesetz nicht als kluge Maßnahme Robert Habecks begrüßt, als Grundgesetzfeind brandmarkt, wer überhaupt alle nicht zum eigenen Milieu zählende Leute für Hinterwäldler und etwas deppert hält, dem hilft auch eine Spitzenkandidatin im Dirndl nicht mehr.
Theoretisch hätten die Bayern-Grünen auch vieles anders machen können. Ihre Anführerin hätte sich die perfide Forderung nach dem Ausschluss der Ungeimpften aus dem öffentlichen Leben verkneifen können. Oder dafür entschuldigen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Saskia Weishaupt hätte Gelegenheit gehabt, ihren Ruf nach Knüppeln und Pfefferspray gegen Anti-Coronamaßnahmen-Demonstranten aufrichtig zu bereuen. Bayerns Grüne hätten sich fragen können, warum selbst die eigenen Parteifreunde weit draußen Windräder im Wald nahe der Kapelle von Altötting ablehnen. Sie hätten über Land fahren und den Freunden in Berlin anschließend melden können, in einem Flächenland mit viel Immobilienbesitz führe das Heizgesetz unweigerlich in die Katastrophe. Nach dem Beitrag in der Süddeutschen über Aiwanger hätten sie sagen können: abwarten, dünne Geschichte, keine Vorverurteilungen.
Überhaupt hätte die Süddeutsche ihren Text als Recherche mit vielen offenen Fragen anlegen und in den folgenden Artikeln ihre redaktionellen Ressentiments gegen die Schwitzigen noch vor dem Tippen mit ein oder zwei Aperol herunterschlucken können. Aber dann wären die einen eben nicht die Grünen, die sich in Bayern prinzipiell nicht anders verhalten als in Berlin, obwohl Bayern prinzipiell anders ist als Berlin. Und die Süddeutsche wäre bei der oben beschriebenen Variante eben nicht die Süddeutsche gewesen.
Als sie sahen, dass ihnen der Schwenk in vorletzter Minute nichts half, rückten die Grünen und ihre Korona wieder in die altbewährte Stellung, vermutlich mit einem Seufzer der Erleichterung, so wie ein etwas überdehntes Gelenk wieder in die heimische Kapsel zurückflutscht. Vier Tage vor der Wahl trommelten Künstler, Adabeis und Medien zu einer Leistungsschau auf dem Odeonsplatz und alle, alle Angesprochenen kamen zu einer reinweißen Ü-50-Mischung aus öffentlichem Dienst, Subventionskunst und Selbständigen im Bereich kostenintensiver Dienstleistungen, um sich Gratismusik anzuhören.
Die beliebte Frage ‚welche Gesellschaft soll das abbilden?‘ beantwortet sich am besten durch eine Grafik.

So trübe es klingt: Solche monochromen Versammlungen ganz nach Geschmack eines sechzigjährigen dauerprogressiven und latent missgelaunten Erdkundelehrers, in der vorgedruckte ‚München bleibt bunt‘-Schilder die Diversität betonen, bilden wirklich den genauen Gegenpol zum Bierzelt. Gegen das Bierzelt kommt in Bayern niemand an die Macht, ohne eine gewisse barocke Üppig- und Lässigkeit eben auch nicht. Die verkörpert zwar der Cola-Light-Trinker Markus Söder ganz gewiss nicht. Dafür aber ein paar andere.
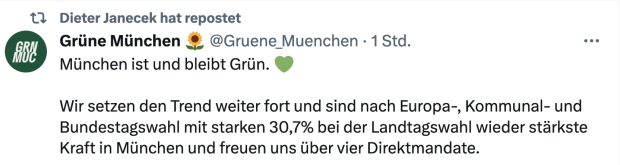
Am Ende ging es den Grünen samt Freunden nur noch darum, auf einem verkehrsgünstig gelegenen städtischen Platz durch Gratisprogramm und mit Medientamtam mehr Leute zusammenzubekommen als die anderen in Erding. Am Wahlabend, als die Zweitplatzierten der Herzen dann doch nur auf Rang vier landeten,
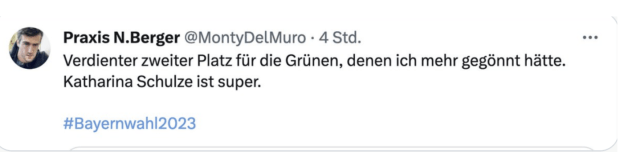
betonte die Partei ihren Sieg in München, im Habitat, wo ihr nur ein Direktmandat verloren ging. Schulze/Hartmann wussten wieder, dass der eben noch umschwirrte Söderfeind den Rechtsrutsch verantwortet, gegen den nur ein grünes Notprogramm hilft.
Und das Gefolge draußen konnte endlich wieder den üblichen Bayernhass von der Leine lassen.
Was die SPD angeht – niemand in Bayern hat etwas gegen sie. Die Wähler vergessen bei den Landtagswahlen nur regelmäßig ihre Existenz. Den Namen des Spitzenkandidaten merken sie sich gar nicht erst. Vermutlich besteht das tiefe Elend der Bayern-Sozialdemokraten darin, dass es in dem Land tatsächlich noch Arbeiter gibt, in München, in Ingolstadt, bei Wacker in Burghausen und anderswo bei vielen kleinen Mittelständlern. Automobilbau und energieintensive Wirtschaft wie beim Polysiliziumhersteller Wacker spielen bei der Wertschöpfung noch eine große Rolle. Die Arbeiter migrieren deshalb zu den Freien Wählern, zur AfD, oder sie bleiben zuhause. Das städtische Künstler-, Beamten- und Yogatrainertum kreuzt längst bei den Grünen an. Viel höher als acht Prozent liegt das eiserne Stammwählerpotenzial der SPD übrigens auch in anderen Ländern nicht.
Ein Verständnis für Bayern gibt es bei der CSU und den Freien Wählern. Umgekehrt aber noch mehr Verständnis der Wähler für beide Parteien und inzwischen auch für die AfD. Die Söder-Partei wählen viele aus einem sehr speziellen staatspolitischen Verständnis von Geben und Nehmen oft genug trotz Söder, denn über Bayerns Gauen ruht nicht unbedingt seine Segenshand (um noch schnell aus der Bayernhymne zu zitieren). Für die Freien Wähler stimmt man deshalb, weil die auf modern gezwirbelte CSU die Stimmen der Schwitzigen immer noch gern nimmt, neuerdings aber nicht mehr so oft mit ihnen gesehen werden möchte, während Aiwanger einer der ihren ist. Und für alle drei Parteien zusammen stimmten gut zwei Drittel, weil sie keine Berlinisierung des Freistaats wünschen. Wenigstens ein Land ohne grüne Mitregenten, finden sie, das tut Deutschland gut. So viel Diversität muss sein.
So ganz anders ist Bayern am Ende doch nicht. Insgesamt findet sich hier etwas mehr Selbstbewusstsein, etwas weniger Duldsamkeit gegen Belehrungen von außerhalb, ein stärkeres Bekenntnis zu Tracht, Maß, Braten und Schweiß als anderswo, außerdem die einmalige Kombination von Seen und Bergen, die geradezu danach schreit, bitte erst einmal den Volkspark Friedrichshain mit Windmühlen zu verschandeln.
Bei seiner Wahlkampfdurchreise sagte der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf der Bühne, er bewundere ja das schöne Land hier und frage sich dann jedes Mal: „Warum CSU?“ Warum, Klingbeil, hält also diese Partei zusammen mit dem schlimmen Aiwanger Seen und Berge in den Klauen? Damit trifft der Parteivorsitzende unbewusst einen wesentlichen Punkt.
Es gibt vermutlich nur wenige, die zwischen Görlitzer Park und Schlesischem Tor flanieren, und fragen: „So ein schöner Stadtteil – aber warum wird er grün regiert?“ In manchen Regionen spielt es keine Rolle, wer oben herumwurstelt. Dort, wo es den Bewohnern nicht egal ist, gibt es einen Grund, nämlich die Bindung an das Spezielle, das man erhalten möchte.
Es wabert durchaus Gegrummel durch das Land über den Opportunismus der CSU, über den Corona-Autoritarismus, auch über die Geschmeidigkeit der Freien Wähler, die gegen die Grünen agitieren, aber nicht gegen Windräder im Wald. Aber alles in allem sind diese Kräfte genauso wie die AfD überhaupt willens und in der Lage, Stimmungen von unten aufzunehmen, während andere Parteien ihre Strategie von der Zentrale aus in enger Abstimmung mit den Medien festlegen, um sie dann bis in den letzten Winkel des Landes zu exekutieren, daran gewohnt, Widerspruch mit Warnrufen wie „Populismus“ und „rechts“ aus dem Weg zu scheuchen. Das mag anderswo noch funktionieren, wenn auch immer schlechter. In der Tiefe des bayerischen Raums ernten sie damit einen Trotz, der sich am Wahlabend in ein paar Extraprozenten niederschlägt.
Eine Mehrheit in Bayern weiß: Die Söders kommen und gehen. Aber Bayern bleibt.



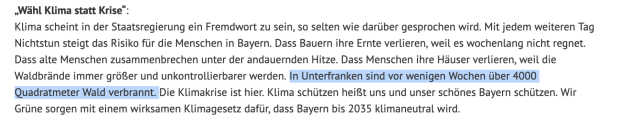
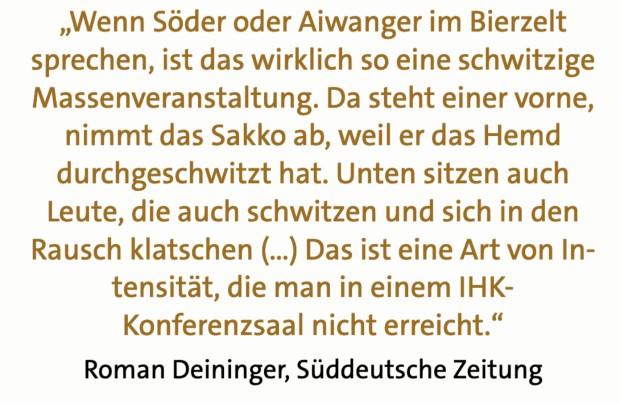
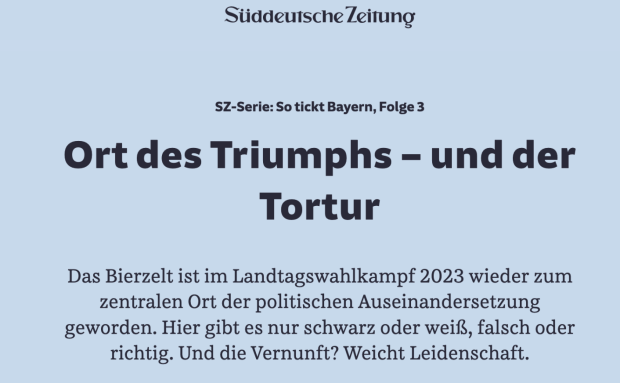

























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Bin eine Woche vor der Wahl an einem SPD-Infostand vorbeigegangen. Dieser wurde von einem kleinen ‚Juso-Kindergarten‘ bewacht. Auf dem Tisch lag nur Material mit LGB-Propaganda. Die ‚schwitzigen MalocherInnen (m/w/d)‘ sind mit Dingen wie: ‘queer the binary’ eben ‚intellektuell überfordert‘. Derlei wird von diesen undankbaren UreinwohnerInnen (m/w/d) dann halt mit Opposition nicht unter dreimal lebenslänglich bestraft.
In Deutschland ist vom Nationalsozialismus lediglich der Sozialismus übrig geblieben, alles Nationale was die Deutschen verbunden hat wurde entfernt. Der Sozialismus hingegen hat sich einfach ein wenig verteilt, hat wie beim Krebs metastasen gebildet, wurde zunehmend schmierig grün, verblassend rot, zeitweise gelb und auch schwarz. Der Sozialismus verspricht neuerdings keinen Wohlstand mehr, ein Versprechen welches er sowieso nie einhalten konnte. Er verspricht neuerdings nichts geringeres als die Rettung des Klimas, welches ohne den grüngefärbten Sozialisten schon bereits Milliarden Jahre existiert hat und dies auch völlig ohne sein Zutun noch weitere Milliarden Jahre tun wird. Er verspricht auch die Rettung der… Mehr
Nochmal: Was soll ein Artikel über Bayern, der gleich im ersten Absatz solide Unkenntnis verrät, weil die Oberpfalz in der Aufzählung der Regionen fehlt?
Früher, als die Welt noch normal war konnte man noch ungestraft feststellen, wer im Dirnd viel „Holz“ vor der Hütte hatte oder auch nicht und dazu wurden doch die Trägerinnen nicht gezwungen, das beruhte auf Freiwilligkeit und sonst nichts und das im erzkatholischen Bayern. Dazu hin war das Dirndl keine Erfindung der Sozis, sondern der Ausdruck barocker Herrlichkeiten und Freude des Lebens in nahezu allen Lebenslagen was wir bei den puritanischen Protestanten und ihrer antichristlichen Entourrage garantiert nicht hätten, wären die die überall durchgedrungen und gottseidank noch Reste von Traditionen vorhanden sind, die doch kein Mensch missen möchte. Fehtl nur… Mehr
Eine sehr gute Zusammenfassung zu den Ergebnissen zu der Bayernwahl. Wer so böse in die Kiste langt wie die SZ muss in Bayern mit Strafe rechnen. Die Wähler wollten eine mitregieren von Rot/Grün verhindern. Schließlich leidet auch Bayern jeden Tag an der Ampel. Die Bayern stört nicht die abfällige Betrachtung der Grünen aus dem fernen Berlin, denn wenn Bayern morgen kein Geld an Berlin überweist aus dem Länderfinanzausgleich und nur noch von Hessen und BW Geld kommt, dann gehen in Berlin teilweise die Lichter aus. Damit zeigen die Bayern ihre Meinung zum Rest der Republik. In Städten wie, Nürnberg, München,… Mehr
Keine Angst, die „Grünen“ werden auf die Dauer schon genug Neubürger aus Afrika und Nahost nach Bayern bringen, bis auch in Bayern rotgrün regiert.
Diese ‚Neubürger‘ wählen dann eigene, von ihnen gegründete (Islam)parteien. Ein Blick nach Schweden, Belgien und die Niederlande genügt!
Exzellenter Artikel! Die Süddeutsche hat nach der Wahl in einem Artikel vorgeschlagen, Landshut als neue Landeshauptstadt zu benennen, weil München (Stichwort viele Grünwähler = gute Stadt) einfach nicht zu Bayern passt . Der Artikel ist leider hinter Bezahlschranke.
Ich bin es einfach gewohnt von Herrn Wendt eine Recherche geliefert zu bekommen, die zur sehr präzisen Analyse auch noch viele Petitessen übrig hat. Ein Super-Artikel.
Die Grünen sollen machen was sie wollen. Die Frage ist: Warum lassen sich 9 von 10 von den Grünen vorführen? Aiwanger ist der einzige, der Paroli bietet!
Wie immer ein Genuß, der Artikel von Herrn Wendt. Trotzdem treibt mich die Frage um: wenn Frau Kata nicht Dirndl trägt, trägt sie dann die 1 x auf Steuerzahlerkosten getragene Garderobe von der feministischen Außenministerin auf? Falls nicht, haben sie wenigstes die gleiche Schneiderin?