Schulschließung, miserabler Digitalunterricht, staatliche Wurstigkeit: In Corona-Zeiten verschärft sich die Verachtung der tonangebenden Klasse für die Bildung. Wie können sich Bürger verteidigen? Zum Beispiel, indem sie „Fahrenheit 451“ neu lesen.

 picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber
picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber
Zwölf, 16, 24, 25: welche Logik liegt hinter dieser Ziffernfolge? Bevor jemand anfängt zu rechnen: Es handelt sich erkennbar um keine Fibonacci-Reihe, aber auch keine Systematik mit Quersummen und Kehrwerten, sondern um die Ränge, die Deutschland seit 2007 in den internationalen Leistungsvergleichen für Mathematik und Naturwissenschaften TIMSS (Trends in International Mathematics ans Science Study) jeweils einnahm. In dem Test der mathematischen Fähigkeiten von Viertklässlern lag das Land, das Carl Friedrich Gauß einmal traditionsstolz auf seinem Zehn-Mark-Schein abbildete, vor 13 Jahren auf Platz 12. In der internationalen Vergleichsrunde von 2019, deren Ergebnisse die TIMSS-Autoren in der vergangenen Woche veröffentlichten, reichte es nur noch für Rang 25. Damals, 2007, kamen Deutschlands Schüler noch auf die gleiche Platzierung wie die der USA. Heute müssen sich die Zehn- bis Elfjährigen der Bundesrepublik nicht nur deutlich hinter den Altersgenossen in den Vereinigten Staaten einordnen, sondern auch hinter den Viertklässlern der Türkei. Seit 2007 hat sich das Feld der Teilnehmerländer verändert und damit auch die Bedeutung des Rangs. Allerdings sinkt seit 2011 auch die Punktezahl der Testteilnehmer aus Deutschland fortlaufend: Von 528 über 522 (2011) auf 521 im Jahr 2019.
In allen Testrunden teilten sich übrigens ostasiatische Länder die Spitzenplätze.
Die coronabedingten Schulausfälle 2020 und im kommenden Jahr werden sich im nächsten Test 2023 niederschlagen. Wobei ja weniger die Lücke im Präsenzunterricht Dauerschäden hinterlassen dürfte, sondern die Tatsache, dass auch zum Beginn des zweiten Lockdowns die meisten Lehrer des Landes über keine Dienstlaptops, viele Schüler über keine Geräte und alle zusammen kaum über eine vernünftige Praxis verfügen, um den Stoff virtuell zu behandeln. Von den fünf Milliarden Euro der von der Bundesregierung beworbenen Digitalisierungsoffensive zur Anschaffung brauchbarer Technik waren bis zur Jahresmitte gerade drei Prozent abgeflossen, was vor allem daran lag, dass viele Beteiligte vom Bundeskabinett bis zu den Schulverwaltungen den Vorgang mit Maßnahmekatalogen, Prüfungen und Bedenken routiniert zum Absturz gebracht hatten. Die Idee, allen Lehrern eine Pauschalsumme zu überweisen, sie selbst Rechner und Kamera kaufen zu lassen und später en détail abzurechnen, verwarfen alle Zuständigen offenbar von Anfang an als eine vermaledeite einfache Lösung, die es bekanntlich nie geben darf.
In der vergangenen Woche kündigte Angela Merkel eine erneute Schulschließung bis zum 10. Januar an, und empfahl, stattdessen „Digitalunterricht zu machen oder was auch immer“. Was bedeutet: Sie weiß also, dass Digitalunterricht in vielen Fällen nicht möglich ist, weil Geräte fehlen, Schulserver überlastet und die Internetverbindungen auf dem Land oft lausig sind. Deshalb empfiehlt sie ja auch ihre Alternativlösung Oderwasauchimmer. Wer glaubte, sie hätte sich einfach nur verhaspelt, für den sagte sie in ihrer Rede noch einmal zum Mitschreiben:
„Es mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist, dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht, das ist auch nicht meine Kompetenz.“
Sie hätte korrekterweise anfügen können, dass es sich bei Sonstwas um ein in der deutschen Bildungslandschaft schon seit Jahren übliches Konzept handelt. Mittlerweile bilden die so genannten Brandbriefe aus Brennpunktschulen ein eigenes Textgenre; ihre Inhalte variieren nur leicht, denn darin erzählen Lehrer immer die gleiche Geschichte, wie sie in Klassen, in denen viele Kinder zuhause kein Deutsch sprechen, und in denen wegen der Inklusionsdoktrin zusätzlich Schüler mit starkem Förderbedarf geparkt sind, kaum noch regulären Unterricht abhalten können, hier beispielsweise nachzulesen in einem Schreiben eines Lehrerkollegiums aus Neukölln von 2018. Auf TE schilderte kürzlich ein Berliner Lehrer seine fast identischen Eindrücke.
Migrantenkinder gelangen unter diesen Umständen oft gar nicht erst in das Bildungssystem hinein. In ihrem Buch „Leaks aus dem Lehrerzimmer“ schreibt eine Berliner Grundschullehrerin unter dem launigen nome de plume Katha Strofe:
„Ich traf ein serbisches Mädchen, das mit elf Jahren nicht schreiben, lesen und rechnen konnte. Sie war nicht die Einzige.“
Der Unterschied zwischen Schulschwänzen und Schulbesuch relativiert sich unter diesen Bedingungen stark, manchmal verschwindet er ganz. Nur besonders bizarre Fälle finden überhaupt noch Medienaufmerksamkeit. Etwa der einer Bremer Schule, in der Kinder von einem Arbeitsblatt „Daten der deutschen Geschichte“ lernen sollten. Zu diesen Daten gehörte unter anderem die Feststellung: „1933 bekam Deutschland wieder einen König. Er wurde auch Führer genannt.“ Der Zweite Weltkrieg begann dem Blatt zufolge 1938, zur deutschen Einheit kam es 1998; nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Deutsche Reich in „Republik Deutschland“ umbenannt und die Demokratie eingeführt: „Nun bekamen die Bürger im Land ein Wahlrecht.“ Das Arbeitsblatt stammte nicht etwa von Schülern, sondern von einer Lehrerin. Es fiel auch nicht an der Schule selbst auf, sondern erst einigen Eltern.
Die hier aufgeführten Beispiele haben nichts mit Corona, Schulschließung und Digitalversagen zu tun. Es handelt sich um Impressionen aus dem Normalbetrieb.
Der Abstieg in Mathematik und Naturwissenschaften, aber auch im Lesen und Schreiben, im Allgemeinwissen, in dem also, was als Bildung gilt, dauert seit Jahren an, er betrifft längst nicht nur Schulen und Schüler. Vor allem führt er zu keiner Alarmstimmung mehr bei denjenigen, die über öffentliches Geld und theoretische Möglichkeiten verfügen, ihn aufzuhalten. Auf die Nachricht von Platz 25 beim Mathematiktest reagierten die meisten Medien mit kleineren Meldungen, Talkshowthema wurde sie bisher nirgends. Die Kultusministerkonferenz erklärte kollektiv und anonym, das Niveau der Schüler liege immerhin „signifikant über dem internationalen Mittelwert“. Das stimmt soweit, der deutsche TIMSS-Testwert in Mathematik rangiert aktuell noch 20 Punkte über dem internationalen Durchschnitt. Allerdings 104 Punkte hinter Singapur.
Der Staatssekretär im Bundesbildungsministerium Christian Luft lieferte den bemerkenswerten Kommentar: „Die Lehrerinnen und Lehrer in unserem Land leisten einen tollen Job! Ihnen ist es in erster Linie zu verdanken, dass deutsche Grundschülerinnen und Grundschüler in Mathematik und Naturwissenschaften ihre Leistungen seit 2007 gehalten haben.“ Christian Luft leistet zumindest ein tolle Karriere; jemand mit seinen Sprach- und Rechenfähigkeiten kann es im Land der gehaltenen Leistung bis zur Staatssekretärsebene schaffen, vorausgesetzt, er gendert seine Textbausteine vorschriftsmäßig.
Anders als die bis ins Jahr 2100 projizierten Globalklimaveränderungen, die bekanntlich den Umbau einer ganzen Industriegesellschaft erzwingen, anders als die angeblich essenzielle Bedrohung durch Rechte und Rassisten, zu deren Abwehr die Bundesregierung ganze Forschungsverbünde errichtet und eine Milliarde Euro spendiert, gehört die Bildungserosion in Deutschland zu den Fußnoten. Der Umgang mit der beschleunigten Misere ähnelt ein bisschen der Reaktion von DDR-Behörden auf den Verfall der Altbausubstanz: Irgendwann ließ sie sich nicht mehr kaschieren, andererseits bröckelten die Gründerzeithäuser zwar, fielen aber nicht sofort um, der Niedergang ließ sich also zeitlich strecken. Die Frage, welche Verhältnisse dazu geführt hatten, und was sich denn ändern müsste, um den Bestand zu retten, hätte das Selbstverständnis der wortwörtlich Verantwortlichen zu stark angetastet. Ähnlich wie Christian Luft lobten die Funktionäre sich selbst und die verdienten Flickschuster des Volkes dafür, das Niveau noch ganz gut gehalten zu haben. Ein Stück über dem Weltdurchschnitt lag man damals auch.
Bei den Gründerzeitvierteln der DDR wie den Bildungsbeständen liegt das Problem tief eingebettet im Verfallsobjekt: Es richtet sich schon in seiner bloßen Existenz gegen die politischen Überzeugungen der jeweiligen Verweser. Beide Objekte stammen aus vergangenen Epochen, also Zeiten der Falschheit. Und zu retten wären sie nur durch Restauration. Restauration der Vergangenheit wiederum ist so ungefähr das Verkehrteste, was jemand aus Sicht der Erwachten und Wohlmeinenden heute fordern, geschweige den betreiben kann.
In der Debatte über die Ausstattung von Lehrern mit Laptops in Corona-Zeiten macht der Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie Dieter Dohmen der NZZ zufolge nicht etwa die allgemeine Bürokratie und die miserable Versorgung mit Breitbandanschlüssen als Hemmnis aus, sondern den „Kulturkampf des Bildungsbürgertums, der bis in die Kultusministerien hineinreicht“, der sich gegen den Fortschritt an sich stemme, gegen den „Abschied vom Wissenskanon der Vergangenheit.“
Diese Formulierung muss man zweimal lesen. Den Wissenskanon der Zukunft kann niemand kennen. Die Gegenwart, eingeklemmt zwischen Vergangenheit und Zukunft, ist zu schmal, um einen eigenen Kanon hervorzubringen. Ausnahmslos alles, was an Schulen und Universitäten gelehrt wird, von Algebra, dem Periodensystem und der Elementarteilchenphysik über die Grammatik bis zur Geschichte – alles gehört zwangsläufig zum Wissenskanon der Vergangenheit. Wenn der Direktor eines Forschungsinstituts empfiehlt, sich davon zu verabschieden, dann gehört das in die Chronik, auch wenn kaum jemand seinen Namen kennt. Es reicht, dass seine Empfehlung befolgt wird. Und das nicht nur in Schulen und Universitäten, sondern eingebettet in ein generelles Klima, das nicht mehr nur durch Gleichgültigkeit bestimmt wird, sondern durch eine obsessive Bildungsverachtung.
So, wie die Gründerzeitbauten in der DDR aus dem kapitalistischen Erbe stammten, das ja gerade überwunden werden sollte, steht der Bildungskanon mit seinem Bildungsbegriff für das alte Europa der alten, weißen, zu männlichen und zu bürgerlichen Kunst und Wissenschaft, mit anderen Worten, für alles, das von den Kräften zwischen Kanzleramt und Grüner Jugend längst zum Abbruch freigegeben wurde. Der Deutschlandfunk, etwa mittig zwischen diesen beiden Dioskuren angesiedelt, erklärte kürzlich Thomas Manns „Buddenbrooks“ zu einem Roman, der wegen seiner „eingeschränkten männlich-bürgerlichen Sichtweise auf die Gesellschaft“ nicht an die Spitze eines Literaturkanons gehöre. Der gleiche Sender stellte ein paar Tage später zum Hamburger Bismarck-Denkmal die Frage: „Abreißen oder umgestalten?“

So lauten die Alternativen mehr oder weniger für die gesamte Vergangenheit. Wobei es noch eine dritte Möglichkeit gibt, einen Kompromiss aus beiden, nämlich den Verfall. Was die Umgestaltung von Denkmalen betrifft: Sie wird beispielsweise von dem „Künstlerkollektiv Peng!“ öffentlich gefordert, hauptsächlich, um Deutschland für seine koloniale Vergangenheit zu strafen; unterstützt werden die Peng-Kollektivisten
unter anderen von der Staatsministerin für Kultur Monika Grütters. Wo etwas gefordert wird, nehmen andere die praktische Seite in die Hand. Etwa die „Jugendlichen“ (Polizeibericht), die vor wenigen Wochen die Granitschale vor dem Alten Museum im Berliner Lustgarten beschmierten. Ganz nebenbei, nur als Fußnote, die auch zu dem Überthema Verfall gehört: Tagesschau, RBB, Bayerischer Rundfunk und T-Online berichteten nur knapp über den Vandalismus, und illustrierten ihre Meldung mit einem Foto der beschmierten Schale, auf der die aufgemalte Parole „hayat kısa insanlar ölüyor“ nicht zu sehen war.
Der Satz, angebracht wenige Tage nach dem islamistischen Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty, lautet übersetzt: „Das Leben ist kurz, Menschen sterben“. Nur sehr wenige Medien erwähnten diesen Spruch überhaupt.
Warum eigentlich? Hier finden die Verachtung der eigenen Kultur und postkoloniale Theorie ideal mit dem Baumarktsortiment zusammen. Wenn wahr wird, was sie in Leitartikeln und Sendungen unentwegt fordern, dann sollten woke Journalisten auch die Nerven haben, dem praktischen Ergebnis ins Gesicht zu sehen.
Zu dem Gesamtbild, das erst deutlich wird, wenn der Betrachter ein paar Schritte zurücktritt, gehören der Direktor eines Bildungsforschungsinstituts, der den Wissenskanon der Vergangenheit für Ballast hält, ein Bildungsstaatssekretär, der den Abstieg im internationalen Vergleich im BWL-Erstsemesterjargon als Niveauhalten bejubelt, nicht minder gehören talibaneske Redakteurinnen eines Kultursenders dazu und eine Talkshowmatadorin und Politikberaterin Ulrike Guérot, die empfiehlt, weniger Mathematik zu wagen. Weil das guttut.
— Ulrike Guérot (@ulrikeguerot) October 8, 2018
Es gehören Grünen-Spitzenpolitikerinnen zum Bild, die davon überzeugt sind, dass sich Elektroenergie im Netz speichern lässt, dass die Nazis die Frauenkirche zerstört haben, dass Bienen und Schmetterlingen den klügsten Personen des Landes zuhören,
und deren esoterisches Meinen & Fühlen mittlerweile aus fast jeder öffentlich-rechtlichen Sendung und jeder Aufführung des permanenten Kirchentags im Berliner Regierungsviertel trieft. Auch im Nachbarland Österreich übrigens, wo die Grüne Jugend weiß, was guttäte:
Bei anderen politischen Kräften wäre das mindestens alltags- wenn nicht vollzeitrassistisch und paternalistisch, wird den Aktivisten aber in dem großen Feld vom grünen Vizekanzler bis Armin Wolf gern nachgesehen.
Zum aktuellen Medien-Sing-Along-Vokabular gehört neuerdings auch der Begriff „wissenschaftsfeindlich“, gemünzt auf alle, die nicht das richtige staatliche Narrativ von Corona-Bekämpfung bis Klimawandel übernehmen wollen. In diesem Medium wurde es schon öfters geschrieben, ist aber gewissermaßen als Beipackzettel immer wieder nötig: Nicht jeder Gegner der Impfpflicht ist ein Impfgegner, längst nicht jeder, der die Corona-Verlautbarungen der Regierung für mäandernd, widersprüchlich und irrational hält, leugnet das Virus und seine Gefährlichkeit, Klimaleugner gibt es überhaupt nicht, Klimawandelleugner sind vermutlich seltener als Mathematiker unter den Grünen, und wer fragt, was eigentlich die Aufstellung immer neuer Subventionsstromerzeuger soll, wenn Speichermöglichkeiten fehlen, der leugnet überhaupt nichts. Sondern eher diejenigen, die Fragen dieser Art niederzischen. Die Wissenschaft, der wir folgen sollen – so lautet die Parole der eigentlichen Wissenschaftsfeinde. Es genügt schon, etwa die Kontroverse zwischen Hans von Storch und Michael Mann über die Hockeystick-Kurve und die von Christian Drosten und Jonas Schmidt-Chanasit nachzulesen, um zu sehen, dass Wissenschaft etwas grundsätzlich anderes ist als ein Fahnenappell. Wissenschaftsfeinde sind eher unter Leuten zu finden, die Schulunterricht unter Sonstwas rubrizieren, den Verlust mathematischer Kompetenz unerheblich finden und die Wissenschaft nur dann bemühen, wenn sie gerade als Stichwortgeber passt, um sich dann wieder bei jedem nicht genehmen Einwand von Wissenschaftlern etwa zu Atom- oder Gentechnik die Ohren zuzuhalten.
Den Verfall von elementarer Bildung plant und inszeniert kein Komitee im Hintergrund. Es handelt sich eher um einen sich selbst beschleunigenden Prozess, in dem wie bei einem Lawinenabgang eins zum anderen kommt. Ein Profiteur der Entwicklung muss noch lange kein Strippenzieher sein. Natürlich gibt es Profiteure. Wer fragt, ob Annalena Baerbock insbesondere an dem naturwissenschaftlichen Bildungsverfall interessiert ist, kann genauso gut fragen, ob Fische Interesse an Wasser haben. Die Frage verliert ihren Sinn, weil sich die Kategorien nicht voneinander trennen lassen. Ohne den gegenwärtigen Bildungsstand gäbe es gar keine Talkshowkönigin und präsumtive Vizekanzlerin Baerbock.
Die Frage ist, wie lange die Lawine rollt, und was sie auf ihrem Weg noch mitnimmt.
Vor weniger Tagen sagte der frühere Präsident des Goethe-Instituts (und immerhin diplomierter Physiker und Mathematiker) Klaus-Dieter Lehmann in einem FAZ-interview über das künftige Humboldt-Forum in Berlin (“das Schloss darf kein Kolonialmuseum werden“): „Wir können Museen nicht mehr so aufstellen, dass sie ein Bildungsbürgertum bedienen, weil es ein Bildungsbürgertum nicht mehr gibt.“
Das ist ein Wort, das keinen Zweifel lässt, woran wir sind. Bildungsbürgertum, das war immer ein offenes Konzept. Im Prinzip konnte und kann jeder dazustoßen. Der Großvater des Autors war Elektriker, von 1918 bis 1970, er absolvierte nur die Volksschule, war aber Abonnent der Büchergilde Gutenberg, in seinem Bücherschrank standen Werke von Thomas Mann und Gottfried Keller. An der Wand hing eine Reproduktion von Vermeers Briefleserin. Er hätte den Begriff Bildungsbürger vielleicht nicht für sich selbst benutzt. Aber von dort, von diesem Begriff kamen seine Orientierungsmarken.
Es gehen auch heute noch mehr Menschen in Museen als in Fußballstadien. Längst nicht jeder Museumsgänger oder Konzertbesucher ist Akademiker. Man darf sich nicht täuschen lassen: Nur, weil das Fernsehen andere Rollenmodelle vorführt, lebt das Bildungsbürgertum durchaus noch. Bedroht war seine Existenz fast immer, was sein Immunsystem lange Zeit eher stärkte. Solange der Wissenskanon nicht verschwindet, kann sich das Bildungsbürgertum immer wieder erneuern. Vielleicht ist es gerade jetzt an der Zeit, Bücherclubs und private Gesprächszirkel zu gründen. Viele, die ihre Kinder am staatlichen Bildungssystem vorbeifädeln, kommen mittlerweile auf die Idee, dass es nicht ganz falsch wäre, das gleiche Prinzip auch auf sich selbst anzuwenden. Frei nach Brecht kann jeder sagen: Gib ihn doch her, den Wissenskanon, wenn du damit nichts anfangen kannst. Bei Brecht heißt es auch: „Lass dir nichts einreden, sieh selber nach/Was du nicht selber weißt, weißt du nicht.“ Sein „Lob des Lernens“ inklusive des Apells: „du musst die Führung übernehmen“ lässt sich mit Kommunismusfolklore lesen – aber auch im Geist von Ayn Rand.
Ray Bradburys dystopischer Roman „Fahrenheit 451“ spielt in einem Land, in dem Bücher verboten sind. Die Feuerwehr ist zuständig dafür, illegale Restbestände aufzuspüren und zu vernichten. Verboten sind sie nicht, weil ein Diktator es so befohlen hätte, sondern, weil sich die Gesellschaft allmählich dorthin entwickelte. Irgendwann kamen ihre wichtigsten Meinungsbildner zu dem Schluss, dass jeder Buchinhalt potentiell diskriminierend und beleidigend wirken und bestimmte Gruppen ausgrenzen könnte. Um einen völlig inklusiven und gerechten Zustand zu schaffen, so lautete ihre Problemlösung, müssten alle Bücher und damit das kulturelle Gedächtnis gelöscht werden. In „Fahrenheit 451“ – der Titel steht für die Entzündungstemperatur von Papier – wird der Feuerwehrmann Guy Montag vom Bücherverbrenner zum heimlichen Buchleser. Am Ende schließt er sich Dissidenten an, die ganze Romane auswendig lernen, um sie vor der Vernichtung zu schützen.
So weit muss bis jetzt kein Bildungsbürger gehen. Es genügt, Politiker zu verachten, die Wissensvermittlung unter Wasauchimmer und Sonstwas abbuchen.
Und zu Weihnachten Bradburys „Fahrenheit 451“ zu bestellen.


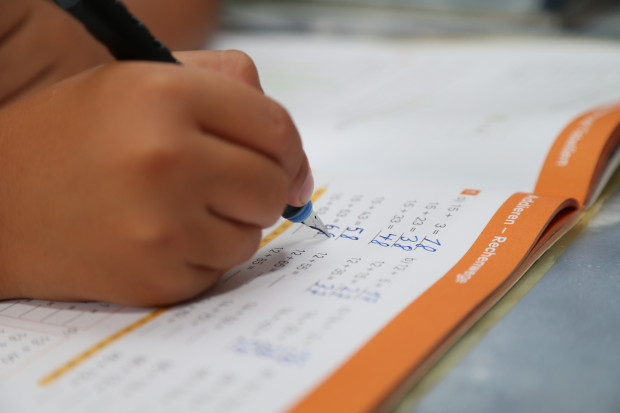




























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Dummheit und Einfalt sind bei einigen (es tut mir leid: vorwiegend weiblichen) grünen Spitzenpolitikern für keinen Wähler zu übersehen, der nicht selbst dumm und/oder … usw. Was soll also das Klagen? Es bleibt lediglich festzustellen, dass es der Generation der Nachkriegsgeborenen nicht gelungen ist, ihre Kinder zu einer wirklichen Nachhaltigkeit, nämlich der Wertschätzung von Bildung, zu erziehen. Das Ding scheint gelaufen zu sein.
Wer die Bildung eines Volkes dem Förderalismus ausliefert, der startet den Wettbewerb … nach unten.
Insbesondere man wenn Bildung bei unzureichender Ausstattung mit politischen Erwartungen überlastet: Teilhabe, Abitur für alle, Inclusion, Ausbildung gewünschter Haltungen u.ä. sorgen dafür, dass andere Felder als der Erwerb von Wissen die Bildung verdrängen. Wenn man für Meinung gute Noten bekommt, dann muss man nicht mehr lernen und wenn man nicht mehr lernt, dann leiden die klassischen Lernfächer am meisten.
Ich wette dass wir bei einem Vergleich im Fach „Staatsbürgerkunde“ im internationalen Vergleich besser abschneiden würden.
Und nicht jeder kann mit Computern umgehen. Ich hatte Kollegen und -Innen, denen es nicht gelang auch nur annähernd selbständig am Computer zu arbeiten. Bei meinen, im übrigen unbezahlten, Weiterbildungen saßen sie immer wieder dabei, hatten den besten Willen, schrieben sich alles eifrig auf, nur um es doch nicht zu können. Die waren nicht dumm, sie hatten einfach keine Ader für IT.
Wenn man denen jetzt das Zeug hinschmeißt und sagt, mach mal, ohne Anleitung – das wird nichts.
“….ist nicht meine Kompetenz.“
Ja was verlangen wir denn auch von der von uns bezahlten und uns allen dienenden Kanzlerin?
Soeben hat sie die EU vor den bösen Briten gerettet. Und nun wird sie die Welt mit einer großen Transformation erneuern. Da bleibt kein Auge trocken.
Zwar hat sie vom Souverän diese Aufträge nicht erhalten, doch das hindert unsere unfehlbare Dienerin nicht, sich die Aufgaben nach ihren eignen Vorstellungen zu suchen – eben Weltenrettung, Zuwanderung, Energiewende und anderer Irrsinn.
Da ist für das Bildungsniveau unserer Kinder weder Zeit, noch Interesse oder gar Steuer-Knete vorhanden. Das müßten wir doch verstehen, oder?
Man kann den Niedergang der Bildung zeitlich verorten mit der Einführung der Gesamt-/Gemeinschaftsschulen. Diejenigen Länder wie Bremen, die diese zuerst einführten, führen heute die Listen an, von hinten gesehen. In BW sieht man diese Tendenz ganz deutlich. Nachdem Grünrot die Gemeinschaftsschulen eingeführt hat, gings im Bundesvergleich rapide bergab. Die sozialistische Gleichheitslehre hält sich halt leider nicht an die Wirklichkeit. Es gibt halt doch gewisse Unterschiede z.B. in der Auffassungsgabe, welche früher durch das dreigliedrige Schulsystem sehr gut aufgefangen wurden und dadurch jeden nach seinen Fähigkeiten förderten. Ein weiteres Problem in BW war, dass sehr viel Geld in die ideologisch korrekten… Mehr
Gemäß dem, was ich so lese, scheint das großmächtige lernsax auch am dritten Tag nacheinander nicht zu funktionieren. Wie sollen nach zuhause verbannte Schüler bei nicht korrekt funktionierender Software noch etwas lernen können, wenn diese lernen wollen? Leute, man kann Physikerin auch wie fies sick äh in aussprechen (sick = krank)! Kommt aus meiner Schulzeit – einen gewissen Lehrer mochte keiner leiden. Seine Kollegin fiel mehr durch extrem kurze Minis auf als durch pädagogische Fähigkeiten.
Eine Ordnung im inszenierten Chaos zu finden und den klaren Kopf zu bewahren ist immer schwieriger. Dass wissenschaftliches Denken und Erkenntnisgewinn bereits länger unterdrückt oder in geordnete Bahnen gelenkt werden soll, fällt bereits länger auf. Erschreckend ist, dass ein großer Teil der Wissenschaftller an den Universitäten sich nicht äußern. Die Neigung politisch Genehmes hervorzubringen ist sehr groß und der Gedanke an das eigene Dasein (z.B. Anstellung, Fördermittel) im Unversitätsbetrieb überwiegt. Nahezu widerspruchslos aktzeptierten die Universitäten z.B. die massenhafte Ansiedelung von Genderprofessuren, die in jedem Fall in erhelblichem Ausmaß Mittel der anderen Fachbereiche abziehen. Wer die Mittel verteilt, bestimmt die Art… Mehr
Anders als ihre Vorgänger hat Merkel nie die Nähe zu Intellektuellen gesucht.
Sie kann keine Intellektuellen gebrauchen und wäre persönlich sicher auch überfordert.
Ein hervorragender Essay dessen Conclusio sich auf viele Bereiche unserer Gesellschaft anwenden lässt. Ich hoffe, dass es in absehbarer Zeit zum Umkehrschub kommt befürchte aber, dass ein imaginärer „point of no return“ bereits passiert wurde. Das Humankapital der deutschen Gesellschaft verändert sich durch Abwanderung der Qualifizierten, Kinderarmut der Autochthonen, Kinderlosigkeit der Gebildeten, vor allem aber durch Einwanderung und hohe Fertilität von Kulturfremden mit geringen kognitiven Fähigkeiten in einer Geschwindigkeit, die diese Befürchtung stützt. Es wird der Tag kommen, an dem die drastischen Auswirkungen dieser Entwicklung im ganzen Land für alle in höchst unangenehmer Weise sicht- und spürbar werden. Dazu bedarf… Mehr
Lieber Herr Wendt, so zutreffend wieder einmal Ihre Analyse ist: winkend an den Bahnhöfen stand 2015 das „Bildungsbürgertum“ mit den gut sichtbaren Bücherwänden im Wohnzimmer und sicher keine Elektriker! . Moralisch hochgesinntes „Bildungsbürgertum“ ohne gesellschaftspolitischen Realismus ist mind. so gefährlich wie der von Ihnen beklagte Niedergang desselben. Diesen Widerspruch herauszuarbeiten, fehlt leider in Ihrem Beitrag.
Um mit Sheldon Cooper zu antworten: Geisteswissenschaften sind keine richtigen Wissenschaften. Päda- Sozio- und andere -ogen sind einfach eine Klasse für sich.