Nach dem Ausscheiden von Katherina Reiche aus dem Bundestag hätten 7 von 29 Abgeordneten, die nur ein Ausgleichsmandat haben, gehen müssen. Aber die Verantwortlichen leiden an Dyskalkulie: angeborener Rechenschwäche, können nicht bis 10 zählen.

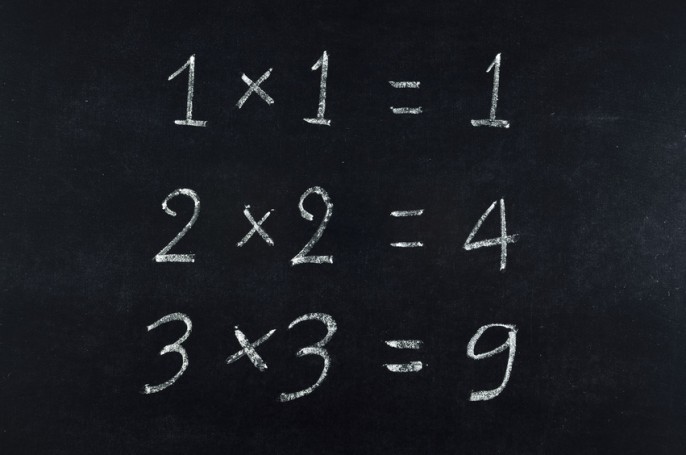 © Fotolia
© Fotolia
Nur sechs Monate vor der Bundestagswahl 2013 brachte Infratest dimap erneut ans Licht, was schon seit Längerem bekannt war: Knapp die Hälfte der Wählerschaft ist sich über die Bedeutung von Erst- und Zweitstimme nicht hinreichend im Klaren. Das ergab eine repräsentative Umfrage vom April 2013, durch die frühere Untersuchungen aus dem Jahr 1998 bestätigt wurden. Ungefähr jeder Zweite der zufällig ausgewählten Wahlberechtigten kann nicht zutreffend beantworten, welche der beiden Stimmen für das Ergebnis der Wahl ausschlaggebend ist.
Nach komplizierteren Sachverhalten wie Überhang- und Ausgleichsmandaten, wie Stimmensplitting oder negativen Stimmengewichten war gar nicht erst gefragt worden, um von Ergänzungsmandaten (lt. § 6 Abs 7 BWahlG) oder Zweitstimmen-Abzug (lt. § 6 Abs 1 BWahlG) überhaupt nicht zu reden. Schwer zu glauben, aber wahr: Die Deutschen wählen nach einem Verfahren, das die gewöhnlich anzutreffenden Wähler nicht mehr ausreichend durchschauen. Das alleine ist Grund genug, die Verfassungsfrage zu stellen.
Und in der Tat hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum „negativen“ Stimmengewicht (BVerfG v. 3.7.2008, BVerfGE 121, 266 (316)) bereits angeordnet: „das für den Wähler kaum noch nachzuvollziehende Regelungsgeflecht der Berechnung der Sitzverteilung im Deutschen Bundestag auf eine neue normenklare und verständliche Grundlage zu stellen“. Karlsruhe hin, Verfassungsgericht her: Der Gesetzgeber ist dem nicht gefolgt.
Diese höchstrichterliche Anordnung und die fehlende Verwirklichung durch den Gesetzgeber sind für die sonst so eifrige Journaille wie ein „böhmisches Dorf“, das niemand kennt. Es verwundert daher nicht, dass die Berichterstattung in Presse und Medien auch bei anderen Fragen, die das Wahlrecht betreffen, am Kern der Sache vorbeigeht. So zuletzt im Fall der SPD-Abgeordneten des Deutschen Bundestags, Petra Hinz. Sie wurde im Sommer 2016 tagelang durch die Schlagzeilen getrieben, weil sie über ihren Bildungsweg und ihre berufliche Qualifikation falsche Angaben gemacht hatte. Ihr wurde zur Last gelegt, die Hochschulreife und das Studium der Rechtswissenschaften vorgetäuscht zu haben. Inzwischen ist die Hochstaplerin – nicht sonderlich ehrenhaft – aus dem Bundestag ausgeschieden. Niemand nahm jedoch Anstoß an dem um Vieles schwerer wiegenden Makel, nämlich dass Petra Hinz – wie übrigens auch Peer Steinbrück – im Wahlkreis verloren hatte und nach der Wahl vom 22. September 2013 trotzdem in den Bundestag einzog. Und genau hier liegt „der Hase im Pfeffer“.
Wahlkreisverlierer mit Bundestagsmandat
Petra Hinz war von der SPD im Wahlkreis Nr. 120 (Essen IIl) aufgestellt worden, konnte sich in der Wahl aber nicht gegen den Mitbewerber, Matthias Hauer, (CDU) durchsetzen. Den Einzug in den Bundestag verdankte sie vielmehr der „Absicherung“ auf einem der vorderen Plätze der Landesliste der nordrhein-westfälischen SPD. Petra Hinz hatte also zwei Mal kandidiert, ein Mal – erfolglos – im Wahlkreis und noch ein Mal – erfolgreich – auf der Landesliste ihrer Partei und konnte deshalb als Wahlkreis-Verliererin trotzdem in den Bundestag einziehen. Nur wer das zutreffend erfasst, kann zu dem richtigen Schluss kommen, dass Petra Hinz niemals hätte in den Bundestag sitzen dürfen. Denn sie hatte als Kandidatin erster Klasse zwei Wahlchancen, die gewöhnlichen Mitbewerber zweiter Klasse dagegen nur eine.
Nun schließt das Wahlrecht eine Doppelkandidatur ausdrücklich aus. Natürlich kann niemand in zwei Wahlkreisen oder auf zwei Landeslisten zur Wahl antreten. „Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag und in jedem Land nur eine Landesliste einreichen.“ So der butterweiche Wortlaut von § 18 BWahlG. Ob man auf der Landesliste und im Wahlkreis kandidieren kann, das lässt das Gesetz offen. Deshalb geht die große Mehrheit davon aus, dies sei zulässig. Das kann aber nicht sein. Denn regulär gibt es im Bundestag 598 Sitze, im Bundesgebiet aber nur 299 Wahlkreise. Daher können grundsätzlich höchstens 299 Abgeordnete im Wahlkreis und auf der Landesliste ihrer Partei kandidieren, haben also zwei Wahlchancen, mindestens 299 Abgeordnete können dagegen nur auf einer Landesliste ihrer Partei zur Wahl antreten, haben also nur eine Wahlchance. Und das lässt sich mit dem ehernen Grundsatz der Wahl unter vergleichbaren Bedingungen, der in Art. 28 GG für die Länder und Gemeinden und in Art. 38 GG für den Bund fest verankert ist, natürlich nicht mehr vereinbaren. Gewiss, höchstrichterlich ist dazu bisher nichts entschieden. Mit der ständigen Praxis hat man sich nicht zuletzt aber auch deshalb abgefunden, weil Presse und Medien die Verfassungsfrage der unzulässigen Doppelkandidatur überhaupt nicht „auf dem Schirm“ haben. Wo kein Journalist, da kein Kläger. Und wo kein Kläger, da kein Richter.
Das ist aber noch nicht der Gipfel der Probleme. Denn das duale Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimme fußt darauf, dass die Bewerber zwei Mal gewählt werden aber nur ein Mandat erhalten. Mit der Erststimme wird über die Person des Abgeordneten in den Wahlkreisen abgestimmt, mit der Zweitstimme über die „Mannschaftsstärke“ der Fraktionen im Parlament entschieden. Man kann vereinfacht sagen, mit der Erststimme wird nominiert, mit der Zweitstimme gewählt (Nominierungstheorie). Und jetzt wird es richtig kompliziert. Denn, wie gesagt, gibt es regulär 598 Sitze im Parlament, insgesamt aber nur 299 Wahlkreise. Deshalb können höchstens 299 Abgeordnete mit beiden Stimmen gewählt werden, mindestens 299 können das nicht. Denn dafür wären ja gar nicht genug Wahlkreise vorhanden. Sind schon das aktive und das passive Wahlrecht nicht deckungsgleich, lässt darüber hinaus das aktive Wahlrecht, für sich alleine genommen, eine Relativierung der Wahlentscheidung zu: Man kann mit der Erststimme anders abstimmen als mit der Zweitstimme und beide Stimmen gegeneinander richten. Keinem Wähler in Großbritannien könnte man klar machen, dass man zwei Stimmen braucht: eine für Labour und noch eine für die Konservativen.
Das Elend des dualen Wahlsystems
Hier zeigt sich das ganze Elend des dualen Wahlsystems mit Erst- und Zweitstimme: Zwei Stimmen sind zwei Wahlen. Man braucht aber nur eine. Und das ist die Ursache allen Übels. Wer mit beiden Stimmen gewählt wurde, erhält ja nur ein Mandat. Wäre Petra Hinz mit beiden Stimmen gewählt worden, wäre es ihr schon physisch unmöglich gewesen, zwei Mal im Bundestag zu sitzen. Auch würde ihr der Bundestagspräsident natürlich nicht gestatten, in Personalunion zwei Mal an der Willensbildung und Gesetzgebung im Parlament mitzuwirken. Die Doppel- oder Zwillingswahl hat also nur einen Wahlerfolg. Das ist die „ratio legis“, die Vernunft des Gesetzes. Im gegebenen Fall muss man sie jedoch mit dem „Index der Fraglichkeit“ versehen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Wähler nach der vorherrschenden Meinung beide Stimmen nicht im Verbund abgeben müssen, obwohl das die meisten Wähler brav und gesetzestreu tun. Doch ein von Wahl zu Wahl schwankender Teil „ausgebuffter“ Wähler tut genau das nicht, spaltet beide Stimmen auf und gibt sie getrennt von einander, also unverbunden ab (Fakultatives Stimmensplitting). Auf der Seite des aktiven Wahlrechts kann man also mit der Erststimme in den Grenzen eines der 299 Wahlkreise eine Person auswählen und mit der Zweitstimme in den Grenzen eines der 16 Bundesländer eine Konkurrenzpartei ankreuzen. Die unverbundene, die gespaltene, die getrennte Abstimmung, d.h. das Stimmensplitting führt also zu einem doppelten Stimmen-Erfolg. Im Ergebnis wird nicht die gleiche Person zwei Mal, sondern zwei verschiedene Personen je ein Mal ausgewählt. Das ganze Verfahren ist vielen Wählern zu kompliziert. Eine ins Gewicht fallende Gruppe von ihnen erkennt aber den wahltaktischen Vorteil des Winkelzugs sofort, entweder die Erst- oder die Zweitstimme als „Leihstimme“ zu vergeben. Dabei kann es sogar zu „negativen“ Stimmengewichten kommen, nämlich dass weniger Zweitstimmen zu mehr Überhangmandaten und neuerdings zu noch mehr Ausgleichsmandaten führen. Zwar hat das Verfassungsgericht das „negative“ Stimmengewicht schon zweimal untersagt (Vgl. BVerfG v. 3.7.2008 BVerfGE 121, 266; und BVerfG v. 27.7.2012 BVerfGE 131, 316.). Der Gesetzgeber ist dem aber auch hier nicht gefolgt.
Bei der Bundestagswahl 2013 gab es 631 Mandate. Das Parlament hat regulär aber nur 598 Sitze, und es gibt insgesamt nur 299 Wahlkreise. Hier passt also gar nichts mehr zusammen. Schlimmer noch entstanden 2013 vier „Überhänge“, jeweils einer in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und im Saarland. Alle bei einer Landespartei der CDU. Diese wurden ausgeglichen, aber nicht durch vier, sondern durch 29 Ausgleichsmandate. Der Ausgleich überstieg den Überhang um mehr als das Siebenfache! Von den 29 nachgeschobenen Ausgleichsmandaten erhielten die CDU 13, die SPD 10, die Linken 4 und die Grünen 2 zusätzliche Listenplätze zugewiesen. Die CSU ging leer aus, protestierte aber nicht. Die CDU wurde demnach als alleinige Verursacher-Partei aller „Überhänge“ zugleich auch zum größten Ausgleichs-Profiteur. – Diesen groben Unfug verstehe, wer es vermag.
Ein überfrachtetes Wahlverfahren
Vollends zum „gordischen Knoten“ geriet das überfrachtete Wahlsystem im September 2015. Damals ist Katherina Reiche (CDU) aus dem Bundestag ausgeschieden und hat kurz, bevor das Karenzzeit-Gesetz in Kraft trat, einen hochdotierten Posten im kommunalen Verbandswesen angenommen. Besonders ehrenvoll war der Abschied aus dem Bundestag also auch bei Katherina Reiche nicht. Aus der Sicht des Wahlrechts ist der Fall aber noch viel bemerkenswerter als der Fall Petra Hinz. Allerdings hatten auch hier Presse und Medien „Tomaten auf den Augen“.
Der Wahlkreis Nr. 061 (Potsdam / Potsdam-Mittelmark II / Teltow-Fläming II), in dem Katherina Reiche mit 32,6 % der Erststimmen gewählt wurde, lag in Brandenburg, wohlgemerkt eines der vier Bundesländer, in denen es bei der Wahl vom 22.9 2013 zu einem sogenannten „Überhangmandat“ kam. Aus der Landesliste der CDU konnte aber kein Nachrücker für die ausgeschiedene Abgeordnete aufgeboten werden, denn auf der „Reservebank“ der Landes-Partei saß niemand mehr, der hätte nachrücken können. Für diesen Fall hat der Gesetzgeber vorgesorgt. In § 48 Abs 1 Satz 4 BWahlG wird angeordnet: „Ist die Liste erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt.“ Seit dem Ausscheiden von Katherina Reiche, hat der Bundestag deshalb nicht mehr 631, sondern nur noch 630 Mitglieder.
Aber das ist nicht der springende Punkt. Bekanntlich sind bei der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag in vier Bundeländern vier „Überhangmandate“ entstanden. Alle bei einer Landespartei der CDU. Die Gewitterwolken zogen sich jedoch über Brandenburg zusammen, wo gleichsam eine Windhose entstand, weil es dort ein „Überhangmandat“ gab. Fällt in Brandenburg ein Direktmandat weg, verändert sich dort auch die Differenz zwischen Listenplätzen und Direktmandaten, die von der Landes-CDU in Brandenburg errungen wurden.
Wer sich die Mühe macht und nachzählt, der kommt zu dem Ergebnis, dass 2013 die Kandidaten der Landes-CDU in 9 von insgesamt 10 Wahlkreisen Brandenburgs siegreich waren. Ein Wahlkreis fiel an einen Bewerber der SPD. Die CDU konnte aber nur 8 Listenplätze erringen und blieb mit einem Listenplatz hinter der Summe der neun Wahlkreissieger aus ihren Reihen zurück. Und das ergibt ein „Überhandmandat“. Bei der Bundestagswahl 2013 sind vier Überhänge in vier Bundesländern entstanden. Sie wurden ausgeglichen, aber nicht durch vier, sondern durch 29 Ausgleichsmandate. Der Ausgleich überstieg den Überhang um mehr als das Siebenfache. Das ist unstreitig und wurde vom Wahlleiter als endgültiges amtliches Wahlergebnis ja auch so verkündet.
Fällt in Brandenburg ein Viertel der insgesamt vier Überhangmandate weg, dann entfällt auch der Rechtsgrund für ein Viertel der 29 Ausgleichsmandate. Demnach müssten 7 von 29 Abgeordneten, die lediglich ein nachgeschobenes Ausgleichsmandat bekleiden, den Bundestag wieder verlassen. Würde man damit Ernst machen, hätte das Parlament in Berlin danach nicht 630, sondern nur 623 Mitglieder. Der Präsident des Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert, stutzt, und der neue Bundeswahlleiter, Dieter Sarreither, kratzt sich am Kopf. Doch er ist unschuldig, denn er hat das neue BWahlG ja nicht gemacht. Seine Aufgabe ist es, die Wahl zu leiten, die vorgeschriebenen Ausgleichsmandate auf die Länder und die Parteien zu verteilen. Also muss er auch den Ausgleich in sachgerechtem Umfang zurückführen, wenn die Zahl der „Überhänge“ zurückgeht. Und fragt man sich, warum das nicht geschieht, dann bleibt eigentlich nur eine Antwort: Die Verantwortlichen leiden an Dyskalkulie: angeborener Rechenschwäche. – Sie können nicht bis Zehn zählen.
Manfred C. Hettlage ist rechts- und wirtschaftspolitischer Publizist. Mehr zur Person des Autors und speziell zum Wahlrecht auf www.manfredhettlage.de.


























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein