Der Einmarsch Russlands in die Ukraine weckt Erinnerungen an eines der berühmtesten Werke der russischen Literaturgeschichte. Doch von der patriotischen Stimmung in Tolstois Roman „Krieg und Frieden“ ist in Putins Reich wenig zu spüren. Trotzdem lohnt es sich, das Mammutwerk zu lesen.
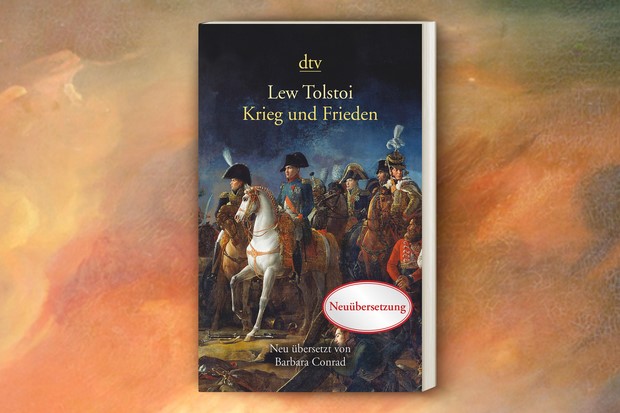
Einer der bedeutendsten Romane der Weltliteratur hat einen neuen Namen: Seit Putins Überfall auf die Ukraine kursieren in Russlands sozialen Medien Bilder, die den Umschlag von Leo N. Tolstois Epos „Krieg und Frieden“ zeigen. Das erste Wort darauf ist durchgestrichen und durch den Begriff „Spezialoperation“ ersetzt.
Auf diese Weise machen sich die User über das Verbot der russischen Regierung lustig, den Einmarsch in die Ukraine als Krieg zu bezeichnen. Obwohl Russland mehr als die Hälfte seiner Truppen in das Nachbarland entsandt hat und es mit Bomben- und Raketenangriffen überzieht, dürfen die gleichgeschalteten Medien den Angriff nur als militärische „Spezialoperation“ bezeichnen. Selbst der vage Slogan „Kein Krieg“, der in vielen Städten auf Demonstrationen zu sehen war und in den sozialen Medien weite Verbreitung fand, wird von den Behörden verfolgt.
Zu diesem Zweck traten in Russland nur wenige Tage nach dem Angriff mehrere Gesetzesänderungen in Kraft. So verbietet Artikel 20.3.3. des Ordnungswidrigkeitengesetzes neuerdings „öffentliche Maßnahmen, die darauf abzielen, den Einsatz der Streitkräfte der Russischen Föderation zu diskreditieren […], einschließlich öffentlicher Aufrufe, um den Einsatz der Streitkräfte der Russischen Föderation zu verhindern“. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu einer Million Rubel (etwa 8000 Euro). Im Wiederholungsfall kann die Tat laut Artikel 280.3. des novellierten Strafgesetzbuchs sogar mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Nach Artikel 207.3 drohen zusätzlich bis zu 15 Jahre Freiheitsentzug für die „öffentliche Verbreitung vorsätzlich falscher Informationen über den Einsatz der Streitkräfte der Russischen Föderation“, wobei die Auslegung, was „falsch“ ist, durch den Staat erfolgt. Viele Russen haben kritische Kommentare zum Ukraine-Krieg in den sozialen Medien deshalb vorsichtshalber gelöscht.
Und zum Krieg haben die meisten Russen ein äußerst emotionales Verhältnis. Jedes Jahr am 9. Mai erinnern Umzüge und Paraden an den „Großen Vaterländischen Krieg“, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird. Praktisch jede Familie hat Tote oder in Zwangsarbeit Verschleppte zu beklagen, deren Fotos bei den Gedenkveranstaltungen hochgehalten werden. Auch in der Sowjetunion stand die Erhaltung des Friedens jahrzehntelang im Mittelpunkt. Noch vor wenigen Wochen erschien den meisten Russen deshalb ein Krieg gegen das ukrainische „Brudervolk“ unvorstellbar.
In Tolstois Roman „Krieg und Frieden“ war das noch deutlich anders. Damals zeigte sich Russland ausgesprochen patriotisch. Auch genoss Zar Alexander die unbedingte Unterstützung eines Großteils der Bevölkerung. Gleichwohl zeigte die russische Armee Schwächen, die in mancher Beziehung an die Schwierigkeiten erinnern, die sie derzeit in der Ukraine hat.
Wer „Krieg und Frieden“ zur Hand nimmt, sollte viel Zeit mitbringen. Die preisgekrönte und exzellente Neuübersetzung von Barbara Conrad umfasst gewaltige 2288 Seiten. Rund 250 Personen tauchen darin auf, die mal mit Vor-, mal mit Nachnamen vorgestellt werden, sodass es nicht ganz einfach ist, den Überblick zu behalten (eine Übersicht der wichtigsten Personen im Anhang hilft dabei). Zudem ist das Werk von französischem Small Talk durchzogen, wie er in höheren russischen Kreisen damals Mode war, was Tolstoi damit auf die Schippe nimmt. Belohnt wird der Leser nicht nur mit der spannenden Schilderung dramatischer historischer Ereignisse, sondern auch mit einem tiefen Einblick in das Russland des frühen 19. Jahrhunderts.
Der Roman, der in der Zeit der Napoleonischen Kriege spielt, beginnt im Jahr 1805, als sich Russland mit England, Österreich und Schweden gegen Frankreich verbündete. Der militärisch begabte junge General Napoleon Bonaparte, der sich selbst zum Kaiser der Franzosen gekrönt hatte, bewirkte damals durch revolutionäre Ideen und eine neue Form der Kriegsführung, dass Frankreich immer mächtiger wurde. Auch Russland erlitt gegen ihn schwere militärische Niederlagen, sodass es 1807 den Frieden von Tilsit schloss, der Europa in eine französische und eine russische Interessensphäre aufteilte.
Trauma durch Einmarsch
Gleichwohl marschierte Napoleon fünf Jahre später mit mehr als 600.000 Soldaten in das Zarenreich ein – ein Trauma, das mit dem Angriff der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist. Obwohl die Franzosen bis nach Moskau kamen, das damals durch einen Brand mit Tausenden Toten weitgehend zerstört wurde, endete der Feldzug mit einer der größten militärischen Katastrophen der Geschichte: Der einbrechende Winter, der Mangel an Nahrung und russische Guerillaattacken sorgten dafür, dass die „Grande Armée“ fast vollständig aufgerieben wurde.
Diese dramatischen Ereignisse lässt Tolstoi wieder aufleben, indem er im Stil des Realismus den militärischen Alltag und die wichtigsten Schlachten schildert. Das einfache Soldatenleben wird dabei ebenso anschaulich wie das Verhalten der Offiziere und Heerführer im Kampf oder bei Lagebesprechungen. Zitate aus zeitgenössischen Briefen, Dokumenten und Berichten verleihen der Darstellung zusätzliche Authentizität.
Den eigentlichen Handlungskorpus des Romans bildet freilich das vielfach miteinander verwobene Leben dreier russischer Adelsfamilien und ihrer Mitglieder. Tolstoi beschreibt ihren Alltag im Frieden, indem er ausführlich Empfänge und Familienfeste, Geburten und Sterbeszenen, Jagden und Schlittenfahrten und zahlreiche weitere Ereignisse schildert. Das höfische Leben in Moskau und Sankt Petersburg wird hier ebenso lebendig wie das eintönige Dasein auf den entlegenen Landgütern im zaristischen Russland, in denen Reformen, wie Tolstoi sie einst selbst auf seinem Gut versuchte, an der Unvollkommenheit der Menschen scheitern. Liebe und Freundschaft, Berechnung und Intrigen bestimmen die Beziehungen zwischen den handelnden Personen und verleihen dem Roman eine Dynamik, der man sich nur schwer entziehen kann.
Tolstoi, der sich ab dem dritten Band als Erzähler immer häufiger selbst zu Wort meldet, demontiert in seinem Roman die bis dahin übliche Darstellung des Krieges als Werk großer Helden. Stattdessen schildert er den Verlauf der Geschichte als Schicksal, auf das die Protagonisten kaum Einfluss haben. Zugleich rückt er die Suche des Einzelnen nach Glück und Verwirklichung ethischer Ideale in den Mittelpunkt.
Vor allem aber lässt er keinen Zweifel daran, mit wie viel Leid der Krieg verbunden ist.
Eine Schlüsselszene dafür findet sich gleich im ersten Teil des Buches. Der junge Student Nikolai Rostow, der aus Begeisterung für den Krieg zur Armee gegangen ist, bemerkt während eines Angriffs der Franzosen, wie ein Husar neben ihm zusammensinkt. Plötzlich wird ihm bewusst, wie schön der Himmel ist, wie hell und feierlich die untergehende Sonne, wie freundlich-glänzend das Wasser der Donau. „Noch einen Augenblick – und ich sehe vielleicht diese Sonne, dieses Wasser und diese Schluchten nie wieder“, fährt es ihm durch den Kopf. Und voller Angst, dass sein junges Leben schon zu Ende gehen könnte, flüstert er: „Herr Gott, der du im Himmel bist, errette mich, vergib mir und beschütze mich.“
Unterwerfung statt Verteidigung
Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass es den jungen russischen Soldaten in der Ukraine derzeit nicht viel anders ergeht. Doch im Unterschied zu den Russlandfeldzügen Napoleons und Hitlers geht es diesmal nicht um die Verteidigung des Vaterlands gegen einen fremden Angreifer, sondern um die fixe Idee eines Despoten, ein nach Unabhängigkeit strebendes Nachbarland zu unterwerfen. Viele Russen haben deshalb Zweifel, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist.
In Tolstois Roman finden sie dafür gute Argumente. In einem Brief bringt zum Beispiel die Tochter des Fürsten Bolkonski ihre Zweifel über den „unseligen Krieg […], in den wir Gott weiß wie und warum hineingezogen worden sind“ zu Papier. Anlass dafür ist, dass in ihrem Dorf ein Trupp Rekruten ausgehoben wurde.
„Es war entsetzlich, den Zustand der Mütter und Kinder dieser Leute mit anzusehen und das Schluchzen der einen wie der anderen zu hören“, schreibt sie. Und fährt fort: „Man möchte sagen, die Menschheit habe die Gesetze ihres göttlichen Erlösers vergessen, der die Liebe gepredigt und Beleidigungen zu verzeihen geboten hat. Denn es scheint, als sähen die Menschen die Kunst, einander zu morden, jetzt als größtes und hauptsächliches Verdienst an.“
Lew Tolstoi, Krieg und Frieden. In der preisgekrönten Neuübersetzung von Barbara Conrad. dtv, 2 Bände im Schmuckschuber, 2288 Seiten, 35,- €.

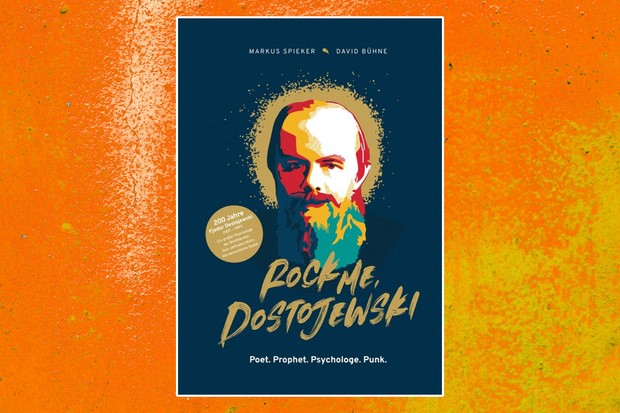
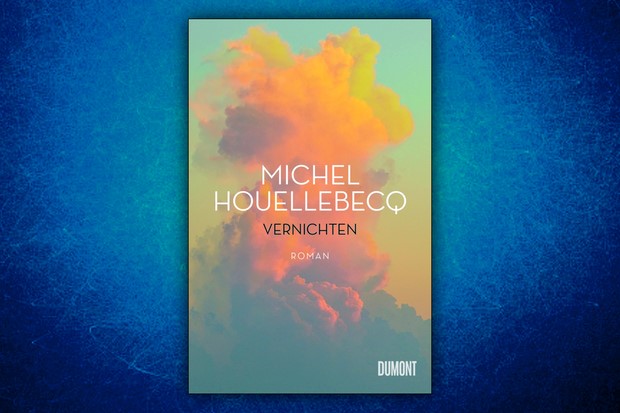
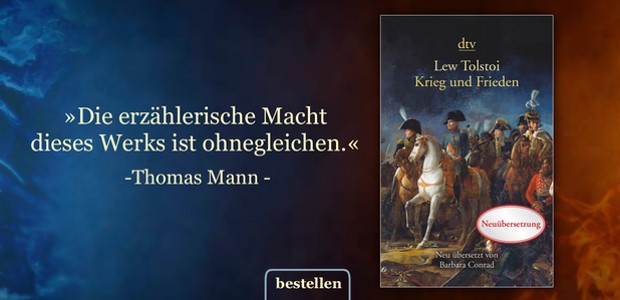

























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Ex-Militär Tolstoi liefert tatsächlich ein ausgezeichnetes Psychogramm des Militärs ab, angefangen vom Heißhunger vieler junger Männer nach Gewalt und Abenteuern über die Sehnsucht alter Männer nach imperialem Gehabe und dann das Hocken im Erdloch unter tagelangem Artilleriebeschuss – ganz und gar nicht glamorös. Auch das elende Sterben im Lazarett (selbst kleinere Verletzungen endeten ohne Antibiotika oft in einer Sepsis tödlich, Amputationen ohne Narkose waren die ultimative Folter) schildert er minutiös.
Herr Knabe, Sie haben treffend die juristischen Sanktionen auf russischer Seite benannt die eine korrekte Bezeichnung der kriegerischen Handlung verhindern sollen. Wie ist denn im Vergleich dazu die Sanktionierung hierzulande zu sehen die einen bedingt zugelassenen gentechnischen Eingriff mit dem Begriff „Impfung“ zu bezeichnen erzwingen soll? Und wie ist die „Freiwilligkeit“ zu verstehen die unser Verfassungsgericht gewahrt sieht wenn ein Angehöriger medizinischer Berufe sich jetzt einen neuen Job suchen soll bloß weil er an diesem medizinischen Experiment seine Teilnahme verweigert? Mir scheint auch diesseits des Dnjepr ist nicht alles Gold was glänzt…. Aber die Schlußfolgerung ist auch heute gültig: „Zugleich… Mehr
Jeder vierte Soldat von Napoleons „Grande Armée“ war ein Deutscher.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1061960/umfrage/verluste-der-franzoesischen-armee-bei-napoleons-russlandfeldzug/
Nie im Leben würde ich eine Neuübersetzung lesen.
Politisch korrekt und womöglich gegendert?
Kann sich jemand Hemingway neu übersetzt vorstellen?
Ich war vor einigen Tagen im Stadttheater Klagenfurt. Der Autor des Stücks soll Shakespeare gewesen sein. Offensichtlich ein ordinäres Arschloch.
Ja, da lobe ich mir meine Schlegel/Tieck-Übersetzung Zuhause.
Weltliteratur kaufe ich mir noch im Antiquariat.
Was für „fairen“ Frieden? Der Russe hat bereits Krim und Donbass erobert. Wer bestimmt, was fair ist, der militärisch Stärkere? Immer noch nicht kapiert, dass diese Kategorie in Europa tabu ist? 90 Jahre Friedensordnung in Europa haben eine Ursache. Die Ausgrenzung von Krieg als Mittel der Politik. Nur deshalb haben wir heute Frieden mit unseren Nachbarn. Nicht wegen der EU. Sondern weil wir Krieg als Macht-Instrument ächten, alle miteinander. Mit einem Kriegstreiber ist nichts zu verhandeln.
Der Vergleich hinkt. Napoleon war es, der damals in Russland einfiel, der es erobern wollte. Russen haben ihr Land und Volk verteidigt. Jetzt verteidigt die Ukraine ihr Land und Volk gegen eine russische Invasion. Die Invasoren werden verlieren. In diesem Punkt passt der Vergleich.
Ein bescheidener Vorschlag: eine Daumen-hoch-Funktion nicht nur für Leserkommentare, sondern auch für Artikel. Dieser Artikel hätte jedenfalls viele positive Bewertungen verdient, meine ich.
Danke, Herr Knabe, dass Sie Bildung und Kultur in die aktuelle Osteuropadebatte hier auf Tichys Einblick bringen. Mir schiessen aktuell zu viele Foristen beim Verständnis für Putin über den Ziel hinaus. Ihr Beitrag unterscheidet sich wohltuend davon, gerade weil Sie einen wenn nicht DEN russischen Autor schlechthin vorstellen.
Ich habe das Werk in verschiedenen Übersetzungen viermal gelesen, immer mit Gewinn. Eindrucksvoll auch für 2022 die Worte des Chef en General Kutusow: „der Plan war gut. Er wurde nur schlecht ausgeführt.“. Auch bzgl Kaukasus findet sich Erhellendes im Werk Tolstois, und so aktuell!
Da fallen mir aber ganz andere Sachen ein, zur literarische Spiegelung von Kriegen mit russischer Beteiligung, 200 Jahre zurück muss an da nicht fassen, zumal der Gottesglauben der Tolstoi-Zeit kaum mehr maßgeblich ist.
Isaak Babel „Reiterarmee“ oder Theodor Plievier „Moskau, Berlin, Stalingrad“ vielleicht auch was von Dwinger.