Wo liegt der unbedingte Punkt, für den jemand bereit ist, alles zu riskieren? Wie passt Unbedingtheit in eine Gesellschaft, die sich daran gewöhnt hat, alles zur Verhandlungssache zu erklären?

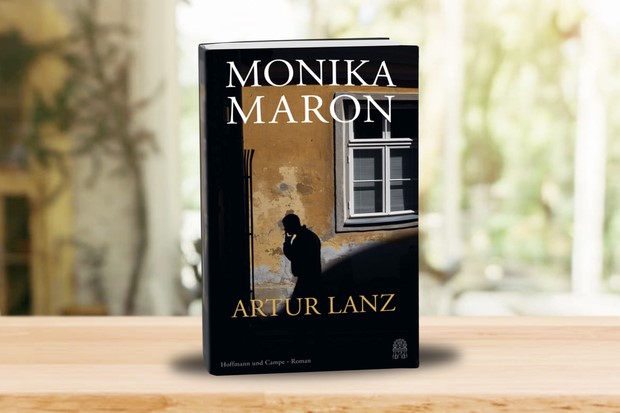
Eine Novelle erzählt von einer unerhörten Begebenheit. Meist läuft sie auf einen Punkt zu, an dem etwas bricht, eine Ordnung, ein Leben, eine Gewissheit. Nach Theodor Storm ist sie darin die Schwester des Dramas. Der Roman »Artur Lanz« von Monika Maron bewegt sich trotz seiner 224 Seiten in der Nähe einer Novelle. In ihr kommen gleich zwei unerhörte Begebenheiten vor, die das Leben der Helden in ein Vorher und Nachher teilen. Eine liegt gewissermaßen außerhalb der Handlung. Artur Lanz, einem Mann um die Fünfzig, muss etwas so Unerhörtes widerfahren sein, dass er wie aussortiert Tag für Tag auf der Bank eines begrünten Berliner Platzes sitzt und mit einem Ast Linien in den Staub zeichnet. Die deutlich ältere Erzählerin des Buchs, Charlotte Winter, wird auf ihn aufmerksam, spricht ihn an und lässt sich von ihm erzählen, wie sein altes Leben einstürzte; zwar nicht gleich beim ersten Mal, aber nach einer zufälligen weiteren Begegnung:
»Vor einem Jahr, im Sommer, seien sie, seine Frau und er, mit ihrem Hund zu Besuch bei Freunden auf dem Land gewesen, ein schönes Anwesen im Oderbruch. Am Nachmittag sei er allein mit dem Hund spazieren gegangen.
Herr Lanz zog sein Telefon aus der Tasche und zeigte mir ein Foto von seinem Hund, ein schwarzer, schnauzbärtiger Mischling, der mich ein bisschen an Nietzsche erinnerte.
Er hätte den Hund an der Leine gehalten, wegen seines ausgeprägten Jagdtriebs und der fremden Umgebung, an einer acht Meter langen Flexileine.
Ein heißer sonniger Tag war es, erzählte Herr Lanz, sonntägliche Ruhe über den Feldern, ein weißbeflockter, herrlicher Himmel, ich gab mich ganz dem Augenblick hin, als sich der Hund plötzlich losriss und mitsamt der Leine in ein endloses Rapsfeld stürmte. Am Griff dieser Leine befindet sich ein schweres Gehäuse, in dem sie aufgerollt werden kann, verstehen Sie, es war mir sofort klar, dass dieser Apparat sich irgendwann im Rapsgestrüpp verheddern würde und der Hund sich nicht mehr befreien könnte. Ich rief, ich pfiff, ich lief hilflos am Rand des Feldes auf und ab. Ich dachte an Hubschrauber und Wärmebildkameras, aber wer würde einen Hund retten wollen mit solchem Aufwand. Ich musste etwas tun.
Dem Hund in das Rapsfeld hinterherzulaufen, war sinnlos, ihn darin zu finden aussichtslos. Ich sah den sterbenden Hund vor mir, mit heraushängender Zunge, erdrosselt beim verzweifelten Versuch, sich zu befreien. Oder langsam und qualvoll verdurstend, ich konnte nicht einfach weggehen und den Hund verrecken lassen. Ich hatte gesehen, dass er neben einer hohen, blaublühenden Pflanze ins Feld gerannt war, und hoffte, er hätte eine sichtbare Spur hinterlassen, aber das verschlungene, lianenartige Gewächs hatte sich wie unberührt hinter ihm geschlossen. Ich kämpfte mich Meter für Meter durch dieses störrische, feindselige Gestrüpp, rief immer wieder vergebens nach dem Hund. Mein Herz, dem ich schon länger nicht mehr ganz vertraute, schlug so wild, dass ich fürchtete, ich könnte selbst sterben bei diesem hoffnungslosen Unterfangen und niemand würde uns finden, weil niemand wusste, wo er uns suchen sollte. Ich weiß nicht, wie weit ich mich durch das Dickicht vorgearbeitet hatte, unter ständigem, mittlerweile atemlosem Rufen, als ich ein zartes Fiepen hörte, zuerst ganz leise, dann, wenn ich seinen Namen rief, immer lauter, bis ich bei ihm war. Die Leine so vielfach verschlungen in dem krummen Gewächs, dass es ihn bald erwürgt hätte. Als wir dem Raps endgültig entkommen waren, musste ich mich ausruhen.
Wir saßen am Wegrand, der Hund unbekümmert, er wusste nichts von der Todesgefahr, in der er gesteckt hatte, und mich überkam mit dem Abklingen meines Pulsschlags allmählich ein wunderbares, ja, ein fast heiliges Gefühl. Ich hatte etwas Unmögliches gewagt, ich hatte sogar mein Leben riskiert. Für einen Hund. Für einen Hund, weil ich ihn liebte. Ich hatte es geschafft, ich hatte ihn gerettet. Ich empfand nicht nur ein tiefes Glück, sondern etwas Unbeschreibliches, etwas sehr Großes. Und als ich so fühlte, dass es meinen ganzen Körper mit einem süßen Schmerz durchströmte, wusste ich, dass ich mich nach einem solchen Gefühl immer gesehnt hatte.«
Allerdings merkt Lanz auch, dass er seinen Hund mehr liebt als seine Frau. Die Ehe geht zu Bruch. Sein Herz liefert einen Infarkt nach.
Die Erzählerin Charlotte Winter, ehemals Verlagsmitarbeiterin, zu DDR-Zeiten in Distanz zum Staat, aber keine Oppositionelle, ist Monika Maron nicht ganz unähnlich, aber kein Selbstbildnis der Autorin. Winter liest sich durch die Heldensagen über König Artus, Lanzelot und andere, sie spricht mit ihren Freunden aus dem Berliner Intellektuellenmilieu über ihren Plan, etwas über Helden zu schreiben und merkt sofort, wie sie zurückzucken. So unzeitgemäß, wie eine Kulturbetriebsnudel es ihr sofort entgegenhält, ist ihre Frage nach dem Punkt der Unbedingtheit offenbar nicht.
Im Fortgang der Handlung trifft sich Lanz mehrmals mit der Erzählerin und liefert nach und nach die Akte eines Dramas, das sich in dem Institut abspielt, in dem er und ein renitenter Kollege arbeiten. »Wer durch mein Leben will, muss durch mein Zimmer«, heißt es bei dem Lyriker Thomas Brasch. Das gilt auch für den Beobachtungsposten der abgeklärten und scharfsichtigen Charlotte Winter: Ihr neuer Bekannter läuft durch ihr Leben. Die Handlungsfäden kommen bei ihr zusammen, ohne dass sie selbst viel dafür tun müsste.
Der Physiker Lanz arbeitet in einem Forschungsinstitut, das sich unter anderem mit der Weiterentwicklung von Windrädern beschäftigt – deren Rotorenblätter sollen mit Duftstoffen versehen werden, die Insekten, Vögel und Fledermäuse fernhalten und so die Kollateralschäden an der Natur begrenzen sollen. Sein Kollege und Freund Gerald, so nimmt es Lanz wahr, steigert sich in die Überzeugung hinein, bei der Klimadebatte ginge es eigentlich um ein gewaltiges Erziehungs- und Gesellschaftsumformungsprojekt, er bezweifelt den Sinn des Energiesektorumbaus, und irgendwann tippt er den Satz von dem »Grünen Reich« auf seine Facebookseite.
Von den Institutsmitarbeitern wird verlangt, sich vom verdächtigen Kollegen zu distanzieren oder ebenfalls verdächtig zu werden. Lanz, der am Feldrand nicht lange nachdachte und überall dort, wo er nachdachte, Risiken aus dem Weg ging, muss sich jetzt entscheiden, ob er sich dem störrischen Freund zuliebe in ein Gestrüpp und Dickicht ganz anderer Art stürzt. Es handelt sich um keine große Unbedingtheit, nur eine kleinere, heruntergekürzt auf den bundesdeutschen Alltag im Jahr 2020 und damit passend für Jedermann.
Heldentum bedeutet für den Romanhelden, sich später nicht schämen zu müssen. Das ist nicht wenig. An einer Stelle spricht die Erzählerin Charlotte Winter von der »Abwesenheit von Bosheit, ohne unscharf zu sein«, die eingestreute Wendung verwendet sie für Fontanes »Stechlin«, den sie gerade liest. Aber die Formel passt auch für ihre teilnehmende Beobachtung. Und sie gilt für Marons Erzählton. Als abgeklärte, ältere Autorin erweitert sie die oft gestellte Frage »was ist los mit den Männern?« auf die Frage: Was ist los mit der Gesellschaft, die schon von dem bloßen Wort »Held« neuralgische Schmerzen bekommt?
»Ich wunderte mich, warum nicht allein diese Formulierung die Menschen in Angst und Schrecken versetzte, warum ihnen bei der Ankündigung einer Transformation ihres gesamten Lebens nicht wie mir reflexhaft die Namen Stalin, Mao und Pol Pot einfielen«, sagt Marons Figur Winter. »Vielleicht musste man tatsächlich Erfahrungen mit so einer Transformation gemacht haben, um ihren Ausgang zu fürchten.«
Dieser skeptische Blick aus Marons DDR-Erfahrung durchzieht das Buch.
»Skepsis« ist wie »Held« zum neuralgischen, fast unerhörten Wort geworden. Monika Maron erzählt von beidem – ohne Bosheit, und mit Beobachtungsschärfe.
Monika Maron, Artur Lanz. Roman. Hoffmann und Campe Verlag, Neuausgabe, Hardcover mit Schutzumschlag, 224 Seiten, 24,00 €.
Empfohlen von Tichys Einblick. Erhältlich im Tichys Einblick Shop >>>



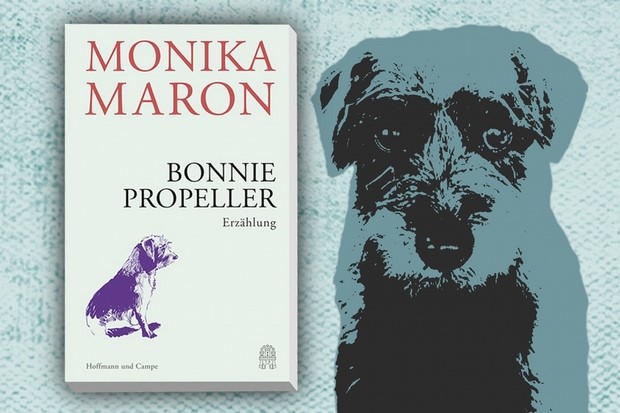

























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Klingt wunderschön nachdenklich diese Rezension, fast so, als würde Monika Maron etwas mit Christa Wolf verbinden. Ein langer Atem der Geschichte. Da fällt mir ein, was mich sehr berührte bei den Statements der Ampel, war es Habeck, war es Baerbock, jedenfalls wählte jemand das Bild von den 6en, die jeder als unabdingbar vor sich sah, während der Verhandlungen. Dem je Gegenüber sahen sie aus wie 9er. Habeck scheint Philosoph und hoffentlich ansteckend für den kommenden Politikstil, bzw. wenn es Frau Baerbock war, dann bin ich mal gespannt, wie sie das bei Lukaschenko und Putin umsetzt oder zumindest bedenkt. Auch der… Mehr
Ja, das ist ein schönes Buch mit einer Sprache, die mich rührt. Wir haben einen Hund, eine Hündin, sie liegt am Liebsten zwischen uns auf dem Sofa. Die Entscheidung, „liebe ich den Hund mehr als den Ehepartner“ hat sich nie gestellt. Nochmal etwas Praktisches, zu der Gefahr der Verhedderung der losgerissenen Leine im Rapsfeld oder im Dickicht: Um den Hund zu orten, trägt der Hund einen Tracker. Ich habe sie mehrfach nur durch Orten im Dickicht befreien können – dieser Hund meldet sich nicht durch Bellen, wenn er sich verfangen hat und daher angreifbar ist. Hockt nur still da. (Irish… Mehr
Ich habe das Buch vor einigen Monaten gelesen. Eine tolle Sprache, ein nachdenkenswerter Inhalt, fesseln und in die Tiefe gehend. Ich kann dieses Buch empfehlen.
Danke lieber Herr Wendt. Und erwartbar ist der Tagesspiegel wie ein Kinderspielzeug auf Knopfdruck in die Institutsmitarbeiterinnenfalle getappt. Herr Lanz mit seinem distanzierten Verständnis für seinen Freund entspricht vermutlich dem Kritiker mit angezogener Handbremse, der bei jeder Distanzierung nie die zweite vergisst. Der unbedingte Punkt ist sehr interessant, ich glaube es ist dasselbe, was Theodore Kaczynski im Unibombermanifest „power process“ meint: höchstes Glück verspricht nur das eigenmächtige ins Risiko gehen für Lebensnotwendigkeiten oder Herzensangelegenheiten. Das beginnt beim Angeln und endet mit der Lebensrettung. Schwer zu machen in einer durchversicherten und exorbitant arbeitsteiligen Gesellschaft. Er sagte die Wahrheit, obwohl er Serienmörder… Mehr
Zumindest die Rezension ist pseudointellektuelles Geschwafel das an der Lebensrealität der Mehrheit vorbei geht. Das macht leider nicht wirklich Lust darauf das Buch zu Lesen. Entschuldigung, das Buch zu kaufen.
Huch!?
Ich finde die Rezension sprachlich sehr gelungen, Wendt eben, der kann es, und bei mir steht das Buch nun auf der Wunschliste.
SOLDATISCHE TUGENDEN haben eigentlich etwas Zeitloses, sind bei uns nach dem letzten Krieg aber in Verruf geraten. Sicher, wer an Stalingrad denkt, dem wird es schwer fallen, damit auch nur in irgendeiner Weise Ritterlichkeit oder ähnliches in Verbindung zu bringen. Aber wenn Stalingrad eines gezeigt hat dann dies: dass soldatische Tugenden nichts mit Kadavergehorsam zu tun haben. Denn der ist in Wirklichkeit Feigheit. Unsere Gesellschaft ist zu einer Waschlappengesellschaft verkommen. Vielleicht hat die Aussetzung der Wehrpflicht dazu beigetragen, ganz sicher ist es aber auch eine Folge der linksgrünen Indoktrination in den Schulen. Wahres Heldentum zeigte ein gewisser Arminius, als er… Mehr