Bemerkenswert bei der von Habermas empfohlenen herrschaftsfreien Kommunikation ist, wer daran nicht teilnehmen darf: Nationalisten, Sozialkonservative, Kritiker der Moderne und Befürworter der freien Marktwirtschaft werden nicht zum Tisch zugelassen, an dem im Habermas’schen Bunker über die Zukunft der Menschheit entschieden wird.
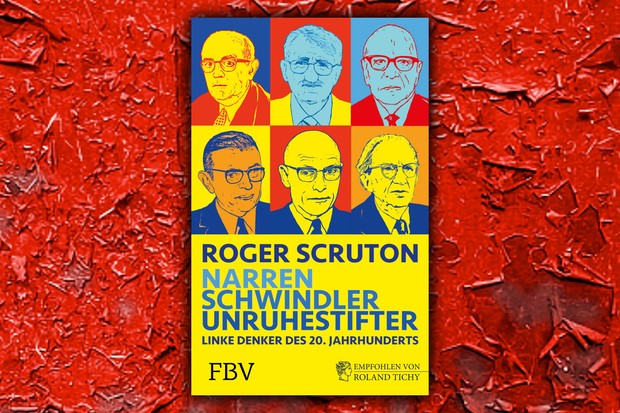
Der Leser, der Habermas zum ersten Mal begegnet und mit den unendlichen Sequenzen seines Schreibens konfrontiert ist, könnte von dem Gedanken, dass er es hier mit dem intellektuellen Kern des linken deutschen Establishments zu tun hat, ein gewisses Entsetzen empfinden. Es verhält sich jedoch genau so, und es ist wichtig, zu erkennen, dass der bürokratische Stil keine Nebensache ist. Im Gegenteil, er ist ein integraler Teil der Botschaft selbst. Der Stil ist die Legitimation, mit dem die Habermas’sche Kritik der bourgeoisen Gesellschaft ihre akademische Berechtigung nachweist. Langeweile ist das Instrument der Autorität des Abstrakten. Der Leser wartet in den Korridoren von Habermas’ Prosa wie ein Antragsteller, dem die Wahrheit versprochen wurde, allerdings nur abstrakt und durch ein Dokument, das möglicherweise bereits überholt ist. (…)
In seinen frühen Werken unterscheidet Habermas zwei verschiedene Formen des gesellschaftlichen Handelns: das »zweckrationale« und das »kommunikative«. Das erste gehört zur Kategorie der »instrumentellen Vernunft« der alltäglichen Menschen, das zweite ist eine »intellektuelle Produktion« der Campusbewohner. Die Unterscheidung zwischen nachgeben und das Maul aufreißen wird als grundlegende theoretische Einsicht verkauft:
»Unter ›Arbeit‹ oder zweckrationalem Handeln verstehe ich entweder instrumentales Handeln oder rationale Wahl oder eine Kombination von beiden. Instrumentales Handeln richtet sich nach technischen Regeln, die auf empirischem Wissen beruhen. Sie implizieren in jedem Fall bedingte Prognosen über beobachtbare Ereignisse, physische oder soziale; diese können sich als triftig oder unwahr erweisen. Das Verhalten rationaler Wahl richtet sich nach Strategien, die auf analytischem Wissen beruhen. Unter kommunikativem Handeln verstehe ich andererseits eine symbolisch vermittelte Interaktion. Sie richtet sich nach obligatorisch geltenden Normen, die reziproke Verhaltenserwartungen definieren und von mindestens zwei handelnden Subjekten verstanden und anerkannt werden müssen.«
Es können zwischen den beiden zweifellos interessante Vergleiche gezogen werden. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass jede Handlung in die eine oder die andere Kategorie fällt. Welcher Kategorie sollen wir ein Fußballspiel zurechnen, eine Jam-Session, eine sexuelle Zusammenkunft, einen Gottesdienst oder ein Familienessen? Es ist kennzeichnend für Habermas, dass er nicht sagt, ob die Unterscheidung exklusiv, vollständig oder absolut ist. (…) So gut wie alles, was in der kapitalistischen Gesellschaft erkennbar falsch läuft, kann am Ende auf die Idee des »zweckrationalen Handelns« zurückgeführt werden, während alles, was uns auf eine bessere Welt hoffen lässt, mit dem Paradigma der »Kommunikation« verbunden ist.
Emanzipation sei – meint Habermas – in erster Linie die Emanzipation der Sprache. Das bezeichnet er später als die »ideale Sprechsituation«. In Anbetracht dessen, dass dieser Vorschlag von einem Autor kommt, dessen Sprache im Kerker seines inhaltslosen Jargons schmachtet, hört sich der Vorschlag einigermaßen paradox an, doch hat er die unverwechselbare Autorität der Tradition auf seiner Seite. Er wiederholt die ursprüngliche Idee der Frankfurter Schule, nach der die Fesseln der bourgeoisen Kultur durch eine andere Form von Bewusstsein gesprengt werden können. Man sucht nicht mehr nach der authentischen Stimme des Proletariats (die nicht verwechselt werden sollte mit der Stimme der tatsächlichen arbeitenden Bevölkerung), sondern nach der idealen Stimme des Akademikers, der in freier Sprache erklären wird, wie es ist. (…)
»Die symmetrische Verteilung der Chancen bei der Wahl und der Ausübung von Sprechakten (…) sind sprachtheoretische Bestimmungen für das, was wir herkömmlicherweise mit den Ideen der Wahrheit, der Freiheit und der Gerechtigkeit zu fassen suchen. Diese Bestimmungen interpretieren sich wechselseitig (…).«
Doch was ist der Wert von Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit, die einander durchdringen – aber nur als Ideen? Was genau kann dieser herrschaftsfreie Diskurs erreichen, außer sich selbst? Was bringt es zum Beispiel meinen Nachbarn, schweigsamen Farmern, die wissen, wie die Dinge getan werden müssen, aber keine Zeit darauf verschwenden, darüber zu reden?
Habermas besteht darauf, dass unsere Redegewohnheiten unerträglich zwanghaft sind, nicht zuletzt deshalb, weil sie »Fragen, die den Werteuniversalismus der bürgerlichen Gesellschaft radikalisieren, gar nicht erst aufkommen lassen«. Doch wenn dieser Satz überhaupt etwas bedeuten soll, ist die Radikalisierung des Werteuniversalismus der kapitalistischen Gesellschaft genau das, was in den akademischen Zirkeln, in denen Habermas beheimatet ist, geschieht.
Sind nun alle einverstanden oder nur vielleicht einverstanden? Geht es um einen existierenden Vertrag oder um einen hypothetischen? Habermas behauptet, über die Sprache zu schreiben. Doch in Wirklichkeit streift er um das alte Thema des Gesellschaftsvertrags herum, ohne die Kant’sche Frage zu stellen, nämlich ob der hypothetische Vertrag ausreicht, um die Legitimität zu sichern, und ob ein gerade gültiger Vertrag seine Geltung verlieren kann. Doch seine wirre und bürokratische Sprache überdeckt diese sehr wichtige Frage und verbirgt auch das Riff, auf dem seine eigene kritische Unternehmung Schiffbruch erleiden muss.
Denn entweder trifft es zu, dass die Menschen unter den jetzt obwaltenden Bedingungen Vertragsfreiheit genießen, und dann müssten wir doch feststellen, dass sie die »kapitalistische« Ordnung implizit akzeptiert haben. Oder aber sie sind nicht frei, und dann wäre die bevorzugte Gesellschaftsordnung jene, die die Menschen unter idealen Bedingungen wählen würden. Dann stellt sich die Frage, wie wir diese idealen Bedingungen definieren würden. Unter welchen Umständen wird die herrschaftsfreie gesellschaftliche Wahl möglich?
Die einzige überzeugende Antwort, die je auf diese Frage gegeben wurde, ist genau jene, vor der Habermas flieht: Die wahrhaft freie und autonome Wahl respektiert die Souveränität des Einzelnen, indem sie ihm ermöglicht, über seinen Willen, seine Arbeit und sein Eigentum frei zu verfügen. Das ist die Antwort, die die Aufklärung auf diese Frage gibt, enthalten in der amerikanischen Verfassung, ausgeführt durch die Theorie der Märkte der Österreichischen Schule und verwirklicht durch die Tradition der westlichen Demokratie. Mit anderen Worten: genau das, was die marxistische Idee vom Menschen als »bourgeoise Ideologie« verworfen hat und was Habermas glaubt, mit seinen geringschätzigen und unklaren Seitenhieben erledigt zu haben. (…)
Die Loyalität zum Bestehenden ist deshalb etwas Gegebenes, von dem uns die Gesellschaftskritik entfernt. Diese Loyalität ist weder bedingt noch zielgerichtet, sie ist eine Form des Eintauchens in die Institutionen, denen wir unsere Identität verdanken. Das ist der Punkt, an dem politisches Denken beginnt: bei den Zusammenschlüssen der Individuen, die durch das Ethos der »kleinen Einheiten« ihre Werte und Zielsetzungen prägen. (…)
Habermas ist kein leidenschaftlicher Revolutionär. Leidenschaftlich vertritt er tatsächlich gar nichts. Soweit er den Realitäten der gesellschaftlichen Konflikte gewahr wurde, bemühte er sich, die »demokratisierenden« Bestrebungen der 68er-Studentenproteste vorsichtig zu unterstützen. In jüngster Zeit war sein Ziel der Dialog mit den Großen und Guten im Interesse einer eurozentrischen Politik, aus dem allerdings die konservativen und nationalistischen Stimmen immer ausgeschlossen waren. In seinen neueren Auftritten als öffentlicher Intellektueller war es ihm wichtiger, die Projekte der europäischen Integration zu unterstützen als irgendeines der alten antikapitalistischen Ziele, allerdings immer auf der Grundlage, dass nicht der freie Markt für Europa wichtig sei, sondern vielmehr die Segnungen des Sozialstaates, die Auflösung nationaler Grenzen und Identitäten sowie die Abgrenzung vom amerikanischen Imperialismus.
Und diese Verteidigung einer aufkommenden sanft-linken, die Völker Europas in einem homogenen Sozialstaat vereinigenden Bürokratie, die die »ideale Gesprächssituation« mit seinen nicht mehr aggressiven Nachbarn anstrebt, ist der natürliche Höhepunkt des Projekts Frankfurter Schule. Das deutsche linke Establishment ist sich seines Status als privilegierte Elite durchaus bewusst. Während es monoton die Verurteilung der Technokratie wiederholt, weiß es in Wirklichkeit ganz genau, dass die »instrumentelle Vernunft«, die Habermas in einem seiner aufrichtigeren Momente als »Arbeit« beschrieben hat, die gesellschaftliche Grundlage seiner Existenz ist. Letztlich ist die Kritik des »zweckrationalen« Verhaltens und das Lob der »idealen Gesprächssituation« nichts anderes als die Ideologie einer Elite, die der realen Welt der modernen Industrie den Rücken kehren und die Würde ihrer eigenen Position als Freizeit-Klasse verteidigen will.
Wie also sollen wir Habermas beurteilen, jetzt, nachdem er mit Preisen geschmückt und seine Stimme als die des neuen Europas anerkannt wurde? Als der letzte lebende Spross der Frankfurter Schule hantierte er über viele Jahre mit marxistischen Kategorien und versuchte neue Wege bei der Formulierung der antikapitalistischen Botschaft zu finden. Am Anfang glaubte er, dass die kapitalistische »Legitimitätskrise« durch die übliche Allianz linker Intellektueller mit sorgfältig ausgewählten und ehrlich ehrerbietigen Vertretern der Arbeiterklasse überwunden werden könnte. Es ehrt ihn, dass er diese närrische Idee später aufgab und statt des alten marxistischen »Kampfes« Dialog, Verhandlung und Sympathie befürwortete. Die neue Agenda jedoch hatte zwar die Form eines politischen Programms, jedoch keinen Inhalt.
Nachdem er jede Realität zugunsten von bürokratischen Abstraktionen beseitigt hatte, war es ihm nicht möglich, zu sagen, worüber er kommunizieren möchte und wie unserer Welt ein Herz verliehen werden könnte. Wenn die einzige Botschaft »Lass uns reden« ist, dann ist es schwer einzusehen, warum wir Bände voll eingedickten Jargons brauchen, um sie zu vermitteln. Bemerkenswert bei den von Habermas empfohlenen Dialogen ist, wer daran nicht teilnehmen darf: Nationalisten, Sozialkonservative, Kritiker der Moderne und Befürworter der freien Marktwirtschaft werden nicht zum Tisch zugelassen, an dem im Habermas’schen Bunker über die Zukunft der Menschheit entschieden wird. Doch indem er so viele Vertreter der normalen Menschheit aus seiner Geschwätzrunde ausgeschlossen hat, vermeidet Habermas die Erörterung der echten Fragen, vor denen wir stehen, und empfiehlt uns, sie zu diskutieren, nur um eine Diskussion zu vermeiden. Ich befürchte, beim neuen Europa geht es genau darum.
Gekürzter und um die im Buch enthaltenen Fußnoten bereinigter Auszug aus:
Roger Scruton, Narren, Schwindler, Unruhestifter. Linke Denker des 20. Jahrhunderts. Edition Tichys Einblick im FBV, 368 Seiten, 25,- €.

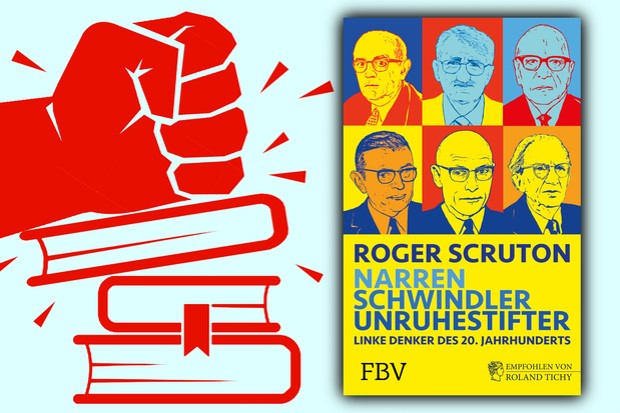
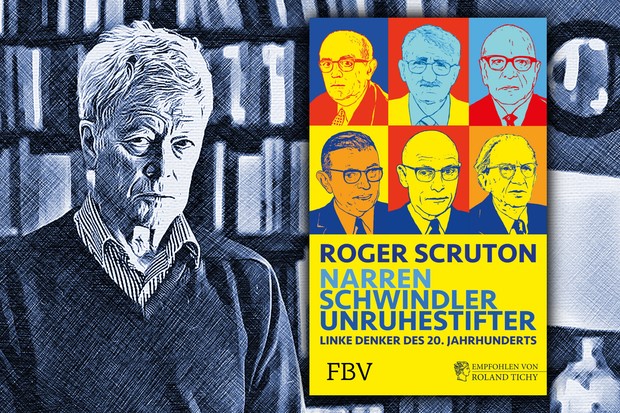

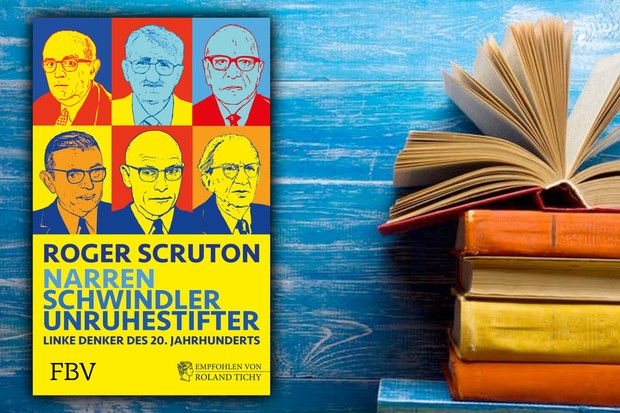
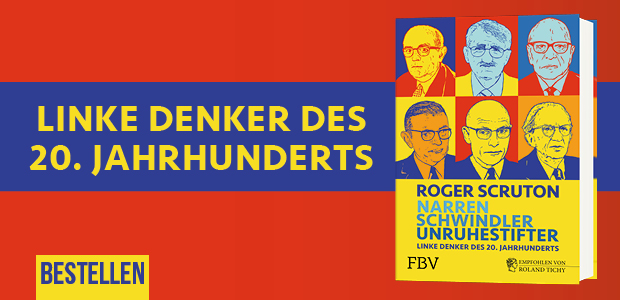























Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Habermas ist der Prototyp eines „Intellektuellen“. Also einer Person deren vollkommene Unfähigkeit zu jedweder produktiver Tätigkeit in scharfem Kontrast zu der eigenen narzisstischen Selbstüberhöhung steht. Camoulfiert wird das durch ihr Talent komplizierte Wörter zu grammatikalisch korrekten, aber völlig sinnlosen Sätzen aneinanderzureihen. Bei mental Unbewaffneten entsteht dadurch der völlig falsche Eindruck von „Bildung“ und „Durchblick“.
Die Verwissenschaftlichung des Banalen durch ein Heer von Ideologen hat doch nur einen Zweck: Ernten ohne säen zu müssen.
Da wird man ja glatt zum Haberms-Fan!
Wobei „Da“ als dem Augenblick verpflichtete, spontane Eregungsspontanität zu verstehen ist.
„Wobei“ meint hier eine dem Thema, es bedarf hier klarer Reziprozität zur inhärenten Aussage, dergestalt und deswegen zubezügliche blablabla… 😉
Das Werk von Jürgen Habermas ist in allen führenden Sprachen der Welt erschienen, leider nicht auf Deutsch!
Altrwerden bringt so manche Erleichterung:
Überlegte man früher, welche Bücher man unbedingt gern lesen würde, so ist man heute froh, alle die ausscheiden zu können, die man auf keinen Fall lesen wird:
Habermas, Heidegger, Precht, Maas… bei Annalena bin ich mir allerdings noch nicht sicher.
„Was liest du zur Zeit?“ – „Telefonbuch.“ – „Und ? Spannend?“ – „Nicht besonders. Zu viele Personen, zu wenig Handlung.“
ABGETÖTETES LEBEN Wer sich die inhaltsleeren, einander überlagernden Verbalorgien eines pseudolinguistisch aufgedonnerten, wichtigtuerischen Schreiberlings à la Habermas eine Zeit lang antut (nicht ZU lang, denn wer auch nur wenig Verstand hat wird merken, dass es verlorene Lebenszeit ist, seinen Sinnesorganen so etwas anzutun), der bekommt nicht nur Kopfweh, sondern vor allem den Eindruck, dass hier jemand seine ganze Lebensenergie darauf richtet, in verquasten Modulationen des Ewiggleichen alles Lebendige totzureden/-schreiben. Als Habermas vor Jahrzehnten mit seinen Verbalabsonderungen anfing gab es noch keine digitalen Medien – daher war es schon damals ein Verbrechen, Bäume zu fällen um Papier zu produzieren, damit so… Mehr
„›Arbeit‹ oder zweckrationalem Handeln“ kommen in der herrschenden politisch-propagandaistisches Klasse nicht vor, soweit es über den Zweck der Machtgewinnung und -erhaltung hinaus geht. Die universitäre Wissenschaft ist eine Unterabteilung der Herrschaftsmaschinerie; besonders sichtbar ist das in den sog. Geisteswissenschaften. Hier wird die verbale Tünche hergetellt, mit der dem Machtapparat einen moralischer Anstrich erhält. Doch auch die Naturwissenschaften dienen, da von der staatlichen Lehrstuhlfinanzierung bis zu den Projektmitteln für den Mittelbau direkt von Ministerien das heisst Parteipolitikern abhängig, letztlich dem Machtsystem. Sie liefern auf Bestellung die „Gutachten“, mit denen idologische Orientierungen und Entscheidungen eine „rationale“ Begründung erhalten. Das gilt nicht nur… Mehr