Eines ist sicher: Die klassischen Medien werden ihre alte Vormachtstellung nie wieder zurückerobern. Das Internet hat die politische Diskussion unwiderruflich demokratisiert. Und das ist auch gut so.
 © John MacDougall/AFP/Getty Images
© John MacDougall/AFP/Getty Images
„Früher war alles besser.“ Das stimmt zwar so nicht, wird aber gerne seufzend vorgebracht – auch von Journalisten. Früher, also vor dem Siegeszug der „Social Media“ gab es zwei unumstößliche Regeln der Massen-Kommunikation. Regel 1: Was nicht in der Zeitung zu lesen, nicht im Hörfunk zu hören und nicht im Fernsehen zu sehen war, hat nicht stattgefunden. Regel 2: Die Medien und die Journalisten bestimmen die politische Tagesordnung.
Früher, das war nicht 1870/71. Das war vor 15 Jahren, als Friedrich Merz über die Sendung „Christiansen“ voll des Lobes sagte: „Diese Sendung bestimmt die politische Agenda mittlerweile mehr als der deutsche Bundestag“. Das war aus dem Munde des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden zwar ein merkwürdiges Eingeständnis, aber es traf durchaus zu.
Das hat sich dramatisch verändert. Natürlich sind und bleiben Journalisten Agenda-Setter. Aber eben nicht mehr nur die Journalisten der klassischen Medien. Themen setzen und Meinung machen kann heute jeder, der in der Lage ist, über Twitter, Facebook, Youtube oder ein anderes der sogenannten sozialen Medien eine hinreichend große Zahl von Menschen zu erreichen, die das Gesagte oder Gestreamte im Netz weiter verbreiten.
In den Bloggern, Influencern und Aktivisten sind den Journalisten der klassischen Medien neue und ernstzunehmende Konkurrenten entstanden. Dazu zählen Blogger und Blogs wie Sascha Lobo, Nachdenkseiten, Achse des Guten oder Tichys Einblick. Oder Influencer wie Florian Mundt alias LeFloid mit mehr als 3 Millionen Abonnenten. Es war kein Zufall, dass sich Angela Merkel vor der Bundestagswahl 2017 von vier Influencern interviewen ließ: von den YouTubern Mirko Drotschmann (Künstlername: Mr. Wissen2Go), Lisa Sophie (ItsColeslaw), Alex Böhm (Alexi Bexi) und Ischtar Isik. Merkels Berater wussten sehr wohl, warum sie die Kanzlerin mit vier Zwanzigjährigen zusammenbrachten: Hinter denen standen damals 3 Millionen Abonnenten bei Youtube.
Journalisten sind keine „Türwächter“ mehr
Der Satz „Was nicht gedruckt oder gesendet worden ist, hat nicht stattgefunden“, stimmt einfach nicht mehr. Der Journalist als „Gatekeeper“, als Türwächter hat ausgedient. Heute gibt es veröffentlichte(n) Meinung(en) jenseits von Zeitungen und Fernsehen. Das Internet hat eine zweite Medienwelt erschaffen. Die klassischen Medien sind sogar häufig die Getriebenen des Internets.
Nichts illustriert die neue Medienwelt besser als die Reaktion der Medien auf die massenhaften Übergriffe in der Silvesternacht 2015 in Köln. Es geschah in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Überregionale Medien berichteten erstmals am Montag, dem 4. Januar – und das noch sehr zurückhaltend. ARD und ZDF stiegen am Dienstag, dem 5. Januar ein, also fünf (!) Tage nach dem Ereignis. Aber im Internet waren die Übergriffe schon von Freitag/Samstag an ein Thema. Zudem wurde dort sehr negativ thematisiert, dass Zeitungen und Fernsehen sich des Themas nicht annahmen oder nicht annehmen wollten. Schließlich passte es nicht zum Geist der „Willkommenskultur“, dass Männer mit Migrationshintergrund, unter ihnen zahlreiche „Flüchtlinge“, massenhaft Frauen sexuell belästigt und bestohlen hatten.
Es lässt sich wohl kaum bestreiten: Ohne „Social Media“ wäre „Köln“ ein lokales Ereignis geblieben. Was ganz im Sinne der meisten klassischen Medien gewesen wäre, nicht zuletzt im Interesse von ARD und ZDF, bei denen die „Willkommenskultur“ besonders gepflegt wurde. Aber „Köln“ hat gezeigt: Die Profi-Agenda-Setter haben ihr Monopol verloren. Sie müssen mit der Konkurrenz der Blogger und Aktivisten rechnen, auch mit der Konkurrenz von politisch interessierten Bürgern, die die neuen Möglichkeiten nutzen, um Nachrichten und Meinungen zu verbreiten.
Welche Bedeutung die „Social Media“ beim Agenda-Setting erlangt haben, zeigt sich auch daran, dass viele bekannte Fernseh- und Zeitungsjournalisten eifrig auf Twitter und Facebook kommentieren.
Sie machen dort aus ihrer politischen Ausrichtung keinen Hehl und rechtfertigen die bisweilen sehr eindeutige Parteinahme mit dem Hinweis, alle Äußerungen seien privat.
Das hat erhebliche Auswirkungen auf die politische Meinungsbildung. Donald Trump hat es vorgemacht: Er ignorierte die klassischen Medien, wurde ohne und gegen sie dennoch Präsident. Die Erfolge der FPÖ in Österreich wären auch nicht möglich gewesen, wenn es der Partei nicht gelungen wäre, sich über „Social Media“ an ihre potentiellen Wähler zu wenden. Die AfD war und ist ebenfalls dabei, ihre eigenen Kommunikationskanäle zu schaffen. So hat die AfD-Facebook-Seite mit inzwischen 410.000 Abonnenten die höchste Reichweite unter allen deutschen Parteien. Die Partei ist auch auf Twitter und Facebook ungleich aktiver als ihre Konkurrenten.
Das Internet hat den politischen Diskurs demokratisiert
Auch die klassischen Medien waren und sind nicht davor gefeit, Falsches zu verbreiten. Aber in den „Social Media“ lassen sich „Fake News“ viel leichter veröffentlichen, weil es eben keine redaktionellen „Gatekeeper“ gibt, die prüfen, was seriöse Information und was Fälschung ist. Welche Folgen die Verbreitung von „Fake News“ haben kann, zeigte sich vor kurzem, als ein Redakteur des Satire-Magazins „Titanic“ mitten im Asylstreit der Unionsparteien die „Nachricht“ verbreitete, CSU-Chef Seehofer kündige das Unionsbündnis auf und die CDU rüstete sich für einen Einmarsch in Bayern. Zahlreiche Medien und eine Nachrichtenagentur fielen darauf herein, verbreiteten den Unsinn sofort über Twitter und mussten ihre Eilmeldungen wieder verschämt zurückziehen. Über die Falschmeldung wurde sogar im Bundestag diskutiert, der Dax verlor ein halbes Prozent, und der Euro gab leicht nach.
Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft, auch beim Verbreiten von Nachrichten und Meinungen. Zweifellos hat die Glaubwürdigkeit der klassischen Medien darunter gelitten, dass in vielen Zeitungen und nicht zuletzt in den öffentlich-rechtlichen Anstalten sich immer mehr Journalisten nicht mehr als Berichterstatter und Kommentatoren verstehen, sondern eher als Meinungsmacher und politische Aktivisten. Dennoch ist die Glaubwürdigkeit von Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen immer noch höher als die von Blogs und Youtube-Kanälen. Je mehr sich in den klassischen Medien jedoch der Meinungsjournalismus zu Lasten des Informationsjournalismus ausbreitet, umso stärker dürfte deren Glaubwürdigkeitsvorsprung darunter leiden.
War früher alles besser? Paul Sethe hat 1965 geschrieben: „Pressefreiheit ist die Freiheit von zweihundert reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten“. Das stimmt so nicht mehr. Die Möglichkeiten zur Verbreitung von Meinungen ist heute dank der „Social Media“ größer denn je. Das alles hat die politische Kommunikation nachhaltig verändert und wird sie noch weiter verändern. Denn eines ist sicher: Die klassischen Medien werden ihre alte Vormachtstellung nie wieder zurückerobern. Das Internet hat die politische Diskussion unwiderruflich demokratisiert. Und das ist auch gut so.
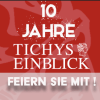











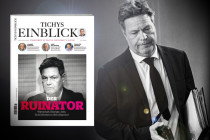















Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Der Vorteil vom Internet ist,dass mehr Leute erreicht werden um sich Meinungen zu bilden. Es gibt natürlich auch Fakenews aber was ist ein Fake? Weiß ich als Bürger ob da oder dort Leute sterben oder die politischen Verwirrspielchen Absicht oder reiner Zufall sind,da ich hier persönlich dabei war. Es gibt ja mehre Meinungsseiten im Internet,wonach Tichys Einblicke eine braune Fakeseite sei. Als Beispiel nennen ich den Bericht über die Seenotretter,die ja nur aus reiner Meschenfteundlichkeit tausende Analphabeten aus dem Meer Fischen und meinen halb Afrika aufnehmen zu müssen.Von Weitblick sind die soweit entfernt wie ich von besteigen des Mount Everest.Ich… Mehr
Es kam noch eine zweite Sache hinzu. Damals war eine Sendung von „Christiansen“ für mich die Spitze des Eisbergs. Sie ließ niemanden mehr zu Wort kommen und unterbrach jeden zweiten Satz. Für mich war das Ende der Talkshows (und bald darauf der Nachrichten) besiegelt auch wenn sich keine alternativen Informationsmöglichkeiten gefunden hätten. Wenn man jemandem nur einen Apfel hinhält und der ist faul, dann muss der den nicht essen, auch wenn es sonst keine Äpfel gibt.
Diesen Aufsatz kann man mit ja und gleichzeitg nein beantworten, denn die Jungen und das Mittelalter bedienen sich immer mehr der Internetnachrichten, wobei die Mainstream- Presse allerdings auch schon kräftig am mitmischen ist und dieser Trend wird sicherlich zunehmen, aber das ändert nichts an der Tatsache, daß ein großer Teil der älteren Bevölkerung sich nachwievor in der örtlichen Tagespresse orientiert und durch das Fernsehen Unterhaltung und gleichzeitig Informationen einholt und die sind bekannterweise linkslastig und solange sich das Verhalten der älteren Bürger nicht ändert, werden auch die derzeit Regierenden gestützt, denn irgendwoher müssen ja die Schwarzen, die Roten und die… Mehr
Nun, mit „zunehmendem Alter“ wachsen auch Einsichten, geprägt von
Lebenserfahrungen… was der „Jugend“ dagegen fehlt.
Das ist kein Vorwurf, das ist halt so.
Es nur auf „Besitzstandswahrung“ zu reduzieren, reicht nicht.
Die Verantwortung gegenüber Kindern und Enkeln beginnt mit
einer neuen „Wertschätzung der Gebärmutter“ als Quelle von Zukunft,
so sie denn geboren werden.
Nicht als „Arbeitskraft“ in Büros, in den Supermärkten, in den Kita-Silos.
Und das erkennt man….. eher mit zunehmenden Alter.
Die Verantwortungslosigkeit wurde mit „68“ begründet,
welche das Heute prägt.
Nicht die Kanzlerin……… ganz im Gegenteil.
„Zweifellos hat die Glaubwürdigkeit der klassischen Medien darunter gelitten, dass in vielen Zeitungen und nicht zuletzt in den öffentlich-rechtlichen Anstalten sich immer mehr Journalisten nicht mehr als Berichterstatter und Kommentatoren verstehen, sondern eher als Meinungsmacher und politische Aktivisten.“ So ist es, die Konsumenten haben es satt, belehrt und agitiert zu werden. Wollte mal ein führendes Medium, wie beispielsweise der „Spiegel“ das lassen und zu objektiver Berichterstattung mit sauberer Trennung von Information und Kommentar zurückkehren, der Auflagenschwund wäre sicherlich gestoppt. Aber da ist die Blase vor. Selbst wer diese erkennt kommt nicht raus, weil der Beifall der Journalsitenkollegen wichtiger ist als… Mehr
„BILD, BamS und Glotze reichen, um Wahlen zu gewinnen“.
So meine Erinnerung……
Was hat sich daran bis heute geändert ???
Die SPD regiert…… die Kanzlerin moderiert…… „frei“ nach Roland Tichy
„Das Internet hat die politische Diskussion unwiderruflich demokratisiert.“ … Wie erklärt man sich dann, dass die sogenannte Willkommenskultur von 2015 ein reiner Medienhype war ohne echte Mehrheit in der Bevölkerung und die Grenzöffnung ein Alleingang von Frau Merkel mit medialer Flankierung aller Mainstream Medien unter Umgehung des Bundestages? War es eine letzte Machtdemonstration, mit der die klassischen Medien, dem verachteten Volk noch mal eins reinwürgen wollten? Steuern wir auf eine explizite Diktatur zu und die „demokratische Diskussion“ soll alsbald wieder abgeschafft werden? Ich kann das Verhalten der klassischen Medien nicht wirklich einordnen, denn wenn sie noch gebraucht werden sollten, dann… Mehr
Ich denke TV und die großen Zeitungen haben immer noch recht viel Einfluss, wenn auch glücklicherweise abnehmend. Wer die Zeit hat, sich auf eigene Recherche im Internet zu machen (und idealerweise auch noch ein paar klasssische Medien selektiv konsumiert) sieht vieles klarer und differenzierter. Eine immer noch große Zahl von Bürgern aber sinken nach meinem Eindruck immer noch abends müde in den Fernsehsessel und dann sind der geistigen Manipulation auf politischem Gebiet leider Tür und Tor geöffnet.
Ich sehe bis heute keinen „Alleingang“ von Fr. Merkel, eher eine „Ausweglosigkeit“, erlaubte die „mediale Flankierung“ keine andere Entscheidung. „Häßliche Bilder“ wären die Folgen einer Grenzschließung, ebenso ein Mißtrauensantrag von rot-rot-grün mit ihrer Mehrheit von 9 Sitzen im Bundestag. Mit einem neuen Kanzler Gabriel UND ES HÄTTE SICH NICHTS GEÄNDERT…….im Gegenteil. So verblieb der Union, der Kanzlerin, die Möglichkeit der Mitgestaltung. Ich sehe bis heute die am „Schwelen“ gehaltene Flüchtlingsfrage eher als politisches Druckmittel von Merkel gegen links-grün, haben sie ihre Mehrheit im Bundestag eingebüßt…. auch gegenüber dem untägigenBrüssel, sind sie jetzt gezwungen worden, Stellung zu beziehen. Es weht jetzt… Mehr
eine interessante Sicht, ich glaub zwar, dass das übertrieben ist (Merkel hat schon sehr hartnäckig die Grenzen offengehalten), aber gut, möglich ist vieles …
,,Dennoch ist die Glaubwürdigkeit von Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen immer noch höher als die von Blogs und Youtube-Kanälen.‘‘ Ha,Ha,Ha,……
aber dann haben Sie Herr Müller-Vogg ja doch noch die Kurve gekriegt! Gut so.
,,Denn eines ist sicher: Die klassischen Medien werden ihre alte Vormachtstellung nie wieder zurückerobern. Das Internet hat die politische Diskussion unwiderruflich demokratisiert. Und das ist auch gut so.‘‘
Die klassischen Medien haben ihre Vormachtstellung noch lange nicht verloren…… 1. erkennbar am Wirken gegenüber der AfD…. keine Chance auf Regieren. 2. erkannbar am Wirken gegenüber der SPD…. immer noch am Regieren. 3. erkennbar am Wirken der GRÜNEN…. immer noch am „Mit-Regieren“ dank MSM. 4. erkennbar am Schicksal der FDP, als von 2009 bis 2013 schwarz-gelb regierte. Zu Beginn hatte schwarz-gelb im Bundesrat die Mehrheit, am Ende dagegen rot-grün, flog die FDP aus fast allen Landesparlamenten. 2013 war eine 14%-FDP auf unter 5 % „eingedampft“, flog aus dem Bundestag und somit aus der Regierung. DIE Bundesrat-Blockade-Macht rot-grün war gegründet, die… Mehr
Zitat: „Auch die klassischen Medien waren und sind nicht davor gefeit, Falsches zu verbreiten. “ Also wirklich, Herr Müller-Vogg, are you kidding?? Die klassischen Medien sind heutzutage NUR NOCH DESWEGEN DA, WEIL SIE FALSCHES IM AUFTRAG DER REGIERENDEN VERBREITEN! Wahrheiten werden als Fake News diskreditiert, Fake News als Wahrheiten verkauft! Und die Journalisten (stimmt diese Bezeichnung denn überhaupt noch, sind es nicht eher Propagandamanager im Dienste der Regierung?) sind nicht Opfer, wie die Formulierung „nicht gefeit“ insinuiert, sie sind die Täter! Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen (siehe Ausländerkriminalität, „Einzel“fälle), es wird mit Bildern manipuliert (Totes Kind am… Mehr
Sie sprechen mir aus dem Herzen. Diese Gesinnungslumpen, die sich tagtäglich ihren Judaslohn „erschreiben“ müssen, für die habe ich nichts als Verachtung übrig.
Der Vorwurf, dass Bürger, die ihre Informationen überwiegend aus den sog. „Social Media“ beziehen, in einer „Blase“ lebten, halte ich für unzutreffend, mindestens aber für übertrieben. Die einzigen die m. E. in einer „Blase“ leben, sind unsere Bundespolitiker. Die leben nämlich in der „Berliner Blase“.
Ich kenne Leute, die sich nur via ÖR-TV und etablierte Tageszeitungen politisch informieren. Auch die leben in einer Meinungsblase in Bezug auf das Migrationsthema oder den sogenannten Rechtspopulismus. Und wenn man diesen Leuten alternative Informationen anbietet, sind sie oft desinteressiert. Das aus den „Leitmedien“ übernommene, einfach gestrickte Weltbild soll erhalten bleiben.
Ich habe diesebezüglich bei einem Gespräch mit einem Kollegen auch einen Eye-Opener gehabt, – ich hatte ihm dargelegt, dass auch die Tagesschau manipuliert und Meinungen unterschiebt – seine Reaktion: er fand das gut …
Die alten Medien stehen vor einem Komplex den sie eigentlich schon vor 20 Jahren hätten erkennen können. Aber wie bei so vielem ist Deutschland im Internet eben nur Dorfliga. Die Internetkultur in Deutschland ist unterentwickelt. Wenn ich aktuelle und wahrheitsgemäße Berichte zu einem Thema suche dann verlasse ich mich auf das englischsprachige Twitter. Dann braucht man nur noch die bekannten Fake News Agenturen wie BBC, CNN oder Fox zu ignorieren und hat einen deutlich besseren Überblick als es mit deutschen Medien je möglich wäre.