Eine Renaissance der Kernenergie ist durchaus denkbar: Wenn es gelingt, mit der Kernspaltung bislang ungekannte Optionen zur Erfüllung von Bedarfen jenseits der Stromerzeugung in Großanlagen anzubieten. Eine Erklärung in zwei Teilen.
 © Fotolia
© Fotolia
Wenn das Spalten von Atomkernen nur für die Stromproduktion taugt, dann ist es aufgrund der vielen alternativen technischen Möglichkeiten nicht notwendig. Wer auch immer warum auch immer die zivile Nutzung der Kernenergie bekämpft, wird daher häufig Erfolg haben. Denn auf Kernkraftwerke kann man allzu leicht verzichten. Wie eine solche Situation entstehen konnte, erläutert der erste Teil einer kleinen Serie zur Zukunft der Kerntechnik.
Am 27. November lehnten die Bürger der Schweiz eine Initiative ab, die sich für die Abschaltung der fünf eidgenössischen Kernkraftwerksblöcke bis zum Jahr 2029 aussprach. Dies als ein Votum für die Kernenergie anzusehen, wäre ein Fehler. Denn die Debatte vor der Volksabstimmung eröffnete den Wählern nur die Wahl zwischen Pest, also Super-GAU und Strahlentod, und Cholera, also steigenden Stromkosten und sinkender Versorgungssicherheit. Wie immer, wenn es um die Kernkraft geht, prallten Ängste auf Ängste und es gewann die Kampagne, die die wirkmächtigeren Emotionen zu schüren verstand. Tatsächlich aber hätten die Schweizer die Pest auch loswerden können, ohne die Cholera in Kauf nehmen zu müssen. Sollten die Optionen für die Wasserkraft tatsächlich ausgereizt sein, genügen zwei oder drei moderne, leistungsstarke Kohle- oder Gaskraftwerke als Ersatz für die ohnehin schon sehr betagten Kernreaktoren. Die Pest wäre weg und die Cholera bräche trotzdem nicht aus, ein stabiles Stromnetz geht auch ohne Uran.
Weil es so einfach ist, ohne sie auszukommen, verliert die Kernenergie den Wettlauf der Bedenken allzu oft. Ihr fehlt das Alleinstellungsmerkmal, ihr fehlt – in der Sprache des Marketings – der „unique selling point“ oder „USP“. Sie bietet keinen einzigartigen Kundennutzen. Kernkraftwerke vermögen nichts, was andere Technologien nicht genauso gut oder gar besser erledigen könnten. Man darf daher die Frage nicht scheuen, ob Kernreaktoren in einem wirklich freien Markt, angesichts der Bedenken der Bevölkerung, hoher Investitionskosten und einer komplexen vor- und nachgelagerten Kette der Brennstoffversorgung und Abfallentsorgung jemals wettbewerbsfähig gewesen wären. Tatsächlich gibt es sie nur, weil die Politik sie einst erzwungen hat. Sie reihen sich damit ein in die Kette staatlich gelenkter Energietechnologien, zu deren jüngsten Gliedern Biotreibstoffe, Solarzellen, Windrotoren und Batteriefahrzeuge zählen. Und wenn Regierungen und Verwaltungen eines nicht beherrschen, dann ist es Innovation.
Von Vielfalt zu Einfalt – die Geschichte der Kernenergie
Aber was ist mit der hohen Energiedichte? Richtig, die Kernspaltung gestattet es, mit sehr wenig Material auf sehr kleinem Raum eine sehr große Menge Energie in sehr kurzer Zeit freizusetzen. Das stellt in der Tat einen USP dar – für eine Bombe.
Deshalb wurde das amerikanische Manhattan-Projekt zum Geburtshelfer der modernen Kerntechnik. Es überbrückte die Kluft zwischen kernphysikalischer Grundlagenforschung und praktischer Anwendung und brachte die Kerntechnik von Beginn an auf den falschen Weg. Denn der Erfolg gelang durch eine mit hohem finanziellen Aufwand aufgebaute Struktur, in der Wissenschaft, Verwaltung und das Militär ihre Bestrebungen auf ein gemeinsames Ziel ausrichteten. Dieser Ansatz prägte die weitere Entwicklung bis in die Gegenwart. Strukturell galt Kerntechnik fortan als staatlicherseits zu fordernde und zu fördernde „Großtechnik“, die nur in einem künstlich geschaffenen institutionellen Rahmen gedeihen könne, der Großforschungseinrichtungen, Großindustrie, Verwaltung und gegebenenfalls auch das Militär einschließt. Technologisch legte man sich auf die Spaltstoffe Uran 235 und Plutonium 239 fest, und auf die für deren Verwendung erforderlichen Verfahren, von der Anreicherung bis hin zur Wiederaufarbeitung.
Aber kann man die Kernspaltung nicht auch nutzen, um aus sehr wenig Material auf sehr kleinem Raum eine große Menge Energie über einen langen Zeitraum hinweg zu gewinnen? Regelbar und bedarfsgerecht? Ja, auch das ist ein USP, für Kriegsschiffe und U-Boote.
Denn diese werden dadurch in einem hohen Maße autark und müssen nicht regelmäßig einen Hafen anlaufen um nachzutanken. Zudem bieten Schiffe ausreichend Raum für den Einbau der entsprechenden Technologie und können die erhebliche Masse der notwendigen Strahlenschutzeinrichtungen leicht tragen. Da es zum Daseinszweck von Frachtern und Passagierschiffen gehört, häufig irgendwo anzulegen, sind die spezifischen Vorteile der Kernenergie für diese Zielgruppe eher gering. Bei militärischen Einheiten sieht das anders aus. Ähnlich wie beim Manhattan-Projekt in der Endphase des Zweiten Weltkriegs spürte die US-Administration auch im kalten Krieg einen gewissen Zeitdruck. Sie wählte daher die erstbeste zur Verfügung stehende Lösung, den technisch vergleichsweise simplen Leichtwasserreaktor, um ihren atomwaffentragenden U-Booten eine infrastrukturunabhängige Bewegungsfreiheit zu verleihen. Nach erfolgreicher Erprobung dieses Ansatzes in der Nautilus entstand in Shippingport in Pennsylvania zwischen 1954 und 1958 der erste „zivile“ Leichtwasserreaktor der USA. Der wohl eher als Test der Energieversorgung künftiger Flugzeugträger diente, denn dem Umbau der Stromproduktion. Das auf angereichertem Uran und der vorgelagerten Herstellungskette für die Brennelemente basierende Brennstoffkonzept wies zudem das Potential auf, den USA dauerhaft eine weltweite Führungsposition in der Nukleartechnik zu sichern. Denn es erforderte den Zugriff auf die Ergebnisse des Manhattan-Projektes. Mit dem „Atoms for Peace“-Programm trieb man daher den Transfer genau dieses Systems in das Ausland voran und stellte interessierten Partnern auch angereichertes Material zur Verfügung. Mit dem Export der kompletten Kette vom Reaktor bis zum Brennstoff sollten nicht nur langfristige Abhängigkeiten, sondern auch Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der künftigen Verbreitung der Kerntechnik geschaffen werden.
Deutschland erwies sich als dankbarer Partner. Als hierzulande ab 1955 die zivile Nutzung der Kernenergie wieder möglich wurde, gründete man zunächst das Ministerium für Atomfragen unter Franz Joseph Strauß. Dieser etablierte in Anlehnung an die in den USA aus dem Manhattan-Projekt hervorgegangenen Strukturen die Deutsche Atomkommission. In einem ersten Schritt wurde die weitere Forschung auf die Entwicklung von Leistungsreaktoren zur Stromproduktion eingegrenzt. Zwar beinhaltete das Forschungsprogramm von 1957 („Eltviller Programm“) noch eine gewisse Vielfalt – man wünschte sich fünf verschiedene Reaktortypen (darunter schwerwassermoderierte und gasgekühlte Natururan-Kraftwerke und Brüter) – aber bald fielen diese Pläne der politisch erzwungenen Hast zum Opfer. Statt dem Aufbau einer unabhängigen deutschen Entwicklungslinie die erforderliche Zeit zu geben, fokussierte sich die Industriepolitik auf den Transfer amerikanischer Technologie nach Deutschland. Schon unter den Forschungsreaktoren dominierten Leichtwassersysteme nach amerikanischem Vorbild. Die Lizenzvereinbarungen der 1960er Jahre zwischen Siemens und AEG auf der einen und General Electric und Westinghouse auf der anderen Seite untermauerten diesen Ansatz. Die einen (AEG) favorisierten dabei Siede-, die anderen (Siemens) Druckwasserreaktoren.
Nun sollte auch bei nur zwei konkurrierenden Systemanbietern ein innovationstreibender Wettbewerb immer noch möglich sein. Tatsächlich aber gab es keinen Markt, auf dem sich ein solcher hätte entfalten können. Die möglichen Kunden für stromproduzierende Leistungsreaktoren waren ausschließlich die Energieversorgungsunternehmen, gering an Zahl und außerdem auch nicht interessiert. Denn eine funktionierende, skalierbare, preiswerte und robuste Stromversorgung war in Deutschland bereits vorhanden, basierend auf fossilen Energieträgern und der Wasserkraft. Große Investitionen in eine neue, weitgehend unerprobte Technologie schienen aus Sicht der Zielgruppe nicht erforderlich. Die gegenüber Kohle und Gas deutlich höhere Energiedichte bietet keinen entscheidenden Vorteil im Bereich thermischer Kraftwerke. Erneut hatte die öffentliche Hand lenkend einzugreifen und die Versorger durch umfassende Subventionierung zu Kauf und Betrieb von Leistungsreaktoren tragen. So wurden die ersten deutschen Kernkraftwerke – etwa in Gundremmingen und Obrigheim – mittels staatlicher Zuschüsse oder günstigen staatlichen Krediten finanziert.
Von Anfang an hatte man dabei mit Vorbehalten in der Bevölkerung zu kämpfen. Politik und Verwaltung reagierten auf diese Stimmungslage und erschwerten den Bau von Kernreaktoren durch immer neue Auflagen und immer komplexere und langwierigere Genehmigungsverfahren. Was Energieversorger und Industrie dazu zwang, an immer weniger verfügbaren Standorten immer leistungsstärkere Einheiten zu bauen. Über drei Reaktorgenerationen wurde innerhalb von nur fünf Jahren die Leistung jeweils verdoppelt: von Obrigheim (Betriebsbeginn 1969) mit 340 MW, über Stade (1972) mit 640 MW bis hin zu Biblis (1974) mit 1.200 MW. Statt wie ursprünglich geplant mittels kleiner, verteilter Kraftwerke eine zum bestehenden Netz alternative dezentrale Energieversorgung zu etablieren, hatte man nun nur mehr eine Ergänzung zu fossil betriebenen Großanlagen. Was wiederum den Betreibern dabei half, Siemens und AEG auf eine Art und Weise gegeneinander auszuspielen, die den Kostendruck enorm steigerte. Folgerichtig verloren die beiden Konzerne den Spaß am Wettbewerb und führten ihre jeweiligen kerntechnischen Branchen 1973 in einer gemeinsamen Tochterfirma zusammen (der Kraftwerk Union KWU). Es gab fortan in Deutschland nur noch einen Anbieter, der sich auch noch auf das Prinzip Druckwasserreaktor konzentrierte und an technischen Lösungen vor allem Boliden in der Leistungsklasse ab 1.200 MW im Angebot hatte. Aus Vielfalt wurde Einfalt.
Zumindest in der Forschung betrachtete man weiterhin die Alternativen. Doch die Möglichkeit, Konzepte wie den Schnellen Brüter oder den Thorium-Hochtemperaturreaktor ähnlich behutsam und sorgfältig wie Leichtwasserreaktoren zur Reife zu bringen, bestand bereits nicht mehr. Die Stimmungslage in der Bevölkerung wechselte zunehmend von Befürwortung zu Ablehnung und die Politik brachte die erforderliche Geduld nicht mehr auf. Beide Konzepte sollten daher den Sprung vom Labor in den Markt ohne Zwischenschritte nehmen. Was nicht gelang.
Am Ende zerfiel das „deutsche Manhattan-Netzwerk“, die künstlich geschaffene Allianz aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Übrig blieben eine Handvoll Forschungseinrichtungen, ein Anbieter und vier Kernkraftwerksbetreiber, alle ausgerichtet auf nur eine Technologie, leistungsstarke Druckwasserreaktoren, für nur einen einzigen Einsatzzweck, die Stromproduktion. Innovationen, durch die sich die Kerntechnik an veränderte Rahmenbedingungen hätte anpassen können, durch die neue Märkte hätten erschlossen werden können, waren nicht mehr möglich.
Die Nachteile des Druckwasserreaktors
Zwar ist ein Druckwasserreaktor technisch durchaus keine schlechte Sache, sondern eine richtig gute Idee. Aber es lassen sich einfach zu viele Szenarien konstruieren, in denen radioaktives Material durch seinen Betrieb freigesetzt wird. Es beginnt mit der Notwendigkeit, Natururan anzureichern, Brennstäbe herzustellen und zum Kraftwerk zu transportieren. Verbrauchte Brennstäbe wiederum müssen abtransportiert und wiederaufgearbeitet werden. Letzteres ist technisch aufwendig, teuer und kaum möglich, ohne kontaminiertes Wasser, kontaminierte Abluft und nicht mehr nutzbare strahlende Reststoffe zurückzulassen. In Deutschland hat man sich daher schon lange vor dem Ausstieg entschieden, auf die Wiederaufarbeitung zu verzichten und gleich die Endlagerung anzustreben. Was die Proteste nicht verstummen ließ, denn wenn man die langlebigen und toxischen Brutprodukte wie Plutonium nicht wieder zur Energieproduktion einsetzt, sind sie für Jahrzehntausende sicher von der Umwelt abzuschließen. Natürlich weist ein Druckwasserreaktor einen negativen Temperaturkoeffizienten auf. Ein Ausfall des primären Kühlkreislaufes führt zu einem Ende der Kettenreaktion und damit der Produktion von Wärme im Reaktorkern. Eine Anlage der 100- oder 200-MW-Klasse geht dann automatisch in einen sicheren Betriebszustand über. Bei den eigentlich nicht intendierten, aber erzwungenen Großanlagen ist das nicht mehr der Fall. Weil die Nachzerfallswärme der in diesen entstehenden weit größeren Mengen an Spaltproduktenkann eben doch eine Kernschmelze auslösen. Ganz gleich aber, ob der Reaktor von innen oder von außen zerstört wird, das Vorhandensein von Wasser und Dampf hat in jedem Fall die Verbreitung von Radioaktivität über ein großes Gebiet zur Folge.
Der Einbau von immer mehr Sicherheitssystemen in immer größerer Redundanz war die falsche Taktik. Der Verweis auf ein immer kleineres „Restrisiko“ hilft nicht gegen grundsätzliche Befürchtungen. Statt Risiken zu vermindern, hätte man sie besser vollständig ausschließen sollen. Um denen die argumentative Grundlage zu entziehen, deren politischer Erfolg auf dem Schüren und Instrumentalisieren von Ängsten beruht. Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung sind mehr als 90% aller Kernkraftwerke weltweit Leichtwasserreaktoren, nicht nur alle deutschen, sondern auch die fünf schweizerischen. Und befragt man Zeitgenossen auf der Straße nach ihren Assoziationen zum Thema „zivile Kernenergie“, so hört man sicher die Begriffskette „Uran“, „Plutonium“, „Brennelement“, „Atommüll“, „Radioaktivität“ und „Verseuchung“. Kerntechnik steht achtzig Jahre nach Otto Hahns und Lise Meitners bahnbrechenden Experimenten nur mehr als Synonym für den stromproduzierenden Leichtwasserreaktor und Fukushima. Dies gilt in der angewandten Forschung ebenso. Wird die Kerntechnik abgewickelt, verschwinden daher nicht nur die Arbeitsplätze in der Industrie, sondern automatisch auch die entsprechenden Lehrstühle an den Hochschulen.
Ein Neustart ist erforderlich
Die Kernkraft hat es auch nicht anders verdient, angesichts der strategischen Fehler, die Unternehmen und Investoren in den vergangenen Jahrzehnten begangen haben. Wer nicht mehr als die Substitution bereits etablierter Systeme anstrebt, ist von einem Gesetzgeber abhängig, der die Rahmenbedingungen zu seinen Gunsten verzerrt. Wer sich aber an die Politik kettet, unterwirft sich den Zufälligkeiten wechselnder Stimmungslagen. Das „Nein“ der Schweizer zu einem schnellen Ausstieg ist angesichts der geltenden Rechtslage nicht viel mehr als ein „Ja“ zu einer etwas längeren Restlaufzeit. Denn auch die Eidgenossen haben wie Deutschland im Jahr 2011 das Ende der friedlichen Nutzung der Kernenergie beschlossen. Nach dem Volksentscheid bleibt es nun einfach bei der bereits vereinbarten Abschaltung der Reaktoren im Jahr 2034.
Die kerntechnische Industrie scheint sich mit ihrem anhaltenden Siechtum bis zum sicheren Tod abgefunden zu haben. Es geht hierzulande wie in der Schweiz nur mehr darum, noch ein wenig mehr an Betriebszeit herauszuschlagen und den Ausstieg so kostengünstig wie möglich abzuwickeln. Dabei wäre eine Renaissance der Kernenergie durchaus denkbar: Wenn es gelingt, mit der Kernspaltung bislang ungekannte Optionen zur Erfüllung von Bedarfen jenseits der Stromerzeugung in Großanlagen anzubieten. Es bedarf dazu eines Ansatzes, der die Magie zurückbringt, mit der die Kernkraft einst in den Augen der Öffentlichkeit zu einem Synonym für Fortschritt und Zukunft wurde. Die Physiker, Chemiker und Ingenieure in den kerntechnischen Wissenschaften und Industrien müssen wieder zu zaubern beginnen. Wie ihnen das gelingen könnte, erzählt der nächste Artikel zum Thema.



















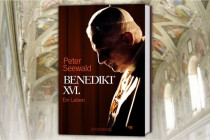







Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein